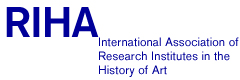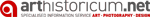RIHA Journal 0153 | 27 June 2017
Die Bauaufgabe Soldatenfriedhof zwischen Friedhofsreform, lokaler Tradition und individuellem Gedenken
Der Ehrenfriedhof des Ersten Weltkriegs auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof1
Abstract
Saarbrücken’s memorial cemetery for the fallen of World War I, a
"war cemetery in the homeland" ("Kriegerfriedhof in der
Heimat"), is an outstanding example in terms of design as well as of social
history among the war cemeteries of that time. In addition to two adjacent ring
systems for German and enemy casualties, the cemetery reserved fields for air
raid victims, for veterans of 1870/71 (!), as well as for Muslim soldiers of the
French occupying forces after the war. The directives on the creation of the
tombs reflect the influences of the cemetery reform movement in Germany. The need
for personal remembrance was also strongly respected and families were allowed to
set up tombstones for their relatives perished in wartime. We know only few war
cemeteries with a comparable “individualized” character.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Ausgangslage
Regelungen zur
Gefallenenbestattung
Zur Grundform des
Saarbrücker Ehrenfriedhofs
Funktionsausweitung
des Ehrenfriedhofs
Die Saarbrücker
"Vorschriften über die Errichtung von Grabmalen auf dem
Ehrenfriedhof" – ein frühes Beispiel konkreter
Gestaltungsvorschriften für Kriegergrabmale
Rezeption
friedhofsreformerischer Ideen
Individuelles
Gedenken durch private Grabmalsetzungen
Individuelles
Gedenken an Kriegergrabmalen als lokale Tradition
Exzeptionell: Ein
Friedhof für Veteranen von 1870/71 im neuen Ehrenfriedhof
Der Saarbrücker
Ehrenfriedhof – Ein Sonderfall in der deutschen Sepulkralkultur?
Einführung
[1] "Es ist ein ganz neuer Zweig der Denkmalskunst von furchtbarem Ernste, den uns der Krieg beschert hat: die Kriegerfriedhofskunst. In dem Lande der Überorganisation verstand es sich von selbst, dass auch diese Betätigung sofort organisiert ward."2 So äußerte sich, nicht ohne Ironie, der bedeutende rheinische Denkmalpfleger Paul Clemen zu den während des Ersten Weltkriegs im Deutschen Reich einsetzenden Anstrengungen, die der Gestaltung von Kriegerfriedhöfen galten. Militärische Friedhöfe gab es zwar schon vorher auf deutschem Boden, etwa Garnison- und Invalidenfriedhöfe. Auch existierten bereits aus Kriegen resultierende Krieger- bzw. Gefallenenfriedhöfe. In den Revolutions- und den Befreiungskriegen, in denen sich Ansätze eines individualisierten Gefallenengedenkens abzeichneten, legte man vereinzelt solche Friedhöfe an, ebenso während der revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 und vermehrt dann während der Einigungskriege.3 Ihre Anlage und Gestaltung war angesichts der neuartigen Erfahrung des massenhaften Kriegstodes im Ersten Weltkrieg aber notgedrungen zu einer drängenden Aufgabe geworden, die der grundlegenden Planung und Organisation bedurfte.4 Das äußerte sich in einer vielfältigen, von Künstlern, Architekten, Politikern und Frontsoldaten getragenen Entwurfs- und Publikationstätigkeit, in Ausstellungen und Wettbewerben, in der Schaffung von "Landesberatungsstellen für Kriegerehrungen", allerdings erst ab 1916, sowie in gesetzlichen Regelungen.5 Ziel war die – wie es meist eher undifferenziert hieß – angemessene wie künstlerische Gestaltung der Friedhöfe und Gräber für die Gefallenen. Dabei unterschied man zwischen Kriegergräbern an oder in der Nähe der Front und solchen in der Etappe, also ein gutes Stück hinter der Front, sowie Kriegerfriedhöfen in der Heimat, auf denen vor allem in Lazaretten verstorbene, aber auch überführte gefallene Soldaten beigesetzt wurden; letztere werden zuweilen auch als "Lazarettfriedhöfe" bezeichnet. Das bekannte, dem Thema gewidmete Werkbund-Jahrbuch 1916/17 trägt diese Unterscheidung sinnfällig im Titel: Kriegergräber im Felde und daheim.
[2] Die folgenden Ausführungen gelten einem "Kriegerfriedhof in der Heimat", dem Ehrenfriedhof des Ersten Weltkriegs auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof, welcher sich für die Erforschung der militärischen Friedhofs- und Grabmalgestaltung gerade jener Zeit als ertragreiches Objekt erweist und darüber hinaus Eigenheiten aufweist, die sepulkral- und kunstgeschichtlich von besonderer Bedeutung sind.
Ausgangslage
[3] Die 1909 durch Vereinigung dreier Saarstädte entstandene Großstadt Saarbrücken hatte kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein weites Terrain an der Grenze zu Lothringen für die Anlage eines Zentralfriedhofs bestimmt. Als der Krieg ausbrach und die Einrichtung eines Gefallenenfriedhofs erforderte, erwog man kurzzeitig, auf der zweithöchsten Erhebung der Stadt, dem Winterberg, einen Heldenhain anzulegen,6 in dem für jeden Gefallenen eine Eiche gepflanzt werden sollte – damals ein reichsweit diskutiertes Konzept, das der Kgl. Gartenbaudirektor Willy Lange aus Berlin-Wannsee vorgeschlagen hatte.7 Die Idee wurde aber rasch wieder fallengelassen und das Terrain des neuen Zentralfriedhofs favorisiert, zumal hier ausreichend erweiterbarer Platz zur Verfügung stand – kein unwesentlicher Vorteil, denn mit Andauern des Kriegs wurde vielfach bei Ehrenfriedhöfen, die innerhalb bestehender Zivilfriedhöfe angelegt wurden, die räumliche Begrenzung zum Problem.8 Am 19. August 1914 fand die erste Beisetzung im Saarbrücker Ehrenfriedhof statt, welcher heute Teil des Ende 1916 eröffneten Zivilfriedhofs, des heutigen Hauptfriedhofs, ist.
Regelungen zur Gefallenenbestattung
[4] Zu Beginn des Kriegs fehlte eine gesetzliche Regelung zur Bestattung der Gefallenen und damit eine klare Kompetenzverteilung und Organisation der mit der Anlage von Kriegsgräbern betrauten Dienststellen. Im Inland wurden diese Aufgaben meist auf lokaler Ebene im Zusammenspiel von Kommunal- und Militärbehörden bewältigt, so auch in Saarbrücken. Dabei beschritt man jedoch unterschiedliche Wege: In manchen Städten wurden die in den Lazaretten verstorbenen und außerdem die von auswärts überführten Krieger, soweit sie aus der betreffenden Stadt stammten, im Ehrenfriedhof beigesetzt, in anderen grundsätzlich nur "Stadtkinder", wieder andere Städte erlaubten nur die Beisetzung der in der jeweiligen Stadt Verstorbenen im Ehrenfriedhof. Manche Kommunen bestimmten jeweils besondere Begräbnisplätze für die Deutschen und die Angehörigen feindlicher Staaten, in anderen wurden Freund und Feind nebeneinander beerdigt, wieder andere erlaubten nur die Beisetzung von deutschen oder von deutschen und österreichisch-ungarischen Kriegsteilnehmern. In Remscheid wurde nach Konfession getrennt beigesetzt, andere Städte betonten ausdrücklich, dass keine Konfessionsunterschiede gemacht würden.9
[5] In Saarbrücken wurden nach Bestimmung des örtlichen Garnisonkommandos alle in Lazaretten der Stadt verstorbene Soldaten, auch Kriegsgefangene, im Ehrenfriedhof beigesetzt, dazu überführte Gefallene, die aus der Stadt waren, nicht jedoch hier verstorbene Militärs, die nicht im Felde gewesen waren. In der Praxis oblag die Durchführung der Grabherstellung und Beerdigungen der Stadtverwaltung, die Gebühren trug die Garnisonverwaltung. Hervorzuheben ist, dass die Gefallenen von Anfang an in Einzelgräbern bestattet wurden, was nicht selbstverständlich war, da entsprechende Regelungen noch fehlten – auch dem Krieger-Sammelgrab (Massengrab) widmete man sich, vor allem noch zu Kriegsbeginn, als neuer Gestaltungsaufgabe.10
Zur Grundform des Saarbrücker Ehrenfriedhofs
[6] Früh war man sich bewusst, dass der Ehrenfriedhof in mehrfacher Hinsicht als Gefallenendenkmal aufzufassen war:11 aufgrund seiner aus Komponenten der Gartenarchitektur und eventuell der Plastik und Architektur zusammengesetzten Gesamtanlage, aufgrund der einzelnen Gräber, die jeweils mit einem Gedenkzeichen zu versehen waren, und schließlich aufgrund später zu errichtender zentraler Denkmäler, an denen Feiern und Kranzniederlegungen durchgeführt werden könnten. Daraus folgte, dass der Ehrenfriedhof auch bei unmittelbarer Nähe zum Zivilfriedhof durch klare Abtrennung eine Insel für sich bilden sollte, deren Binnenstruktur als geschlossene Einheit aufzufassen war.
[7] Dementsprechend entschied die städtische Garten- und Friedhofsverwaltung Saarbrückens, die Soldatengräber gleichmäßig in durch Bepflanzung abgegrenzten konzentrischen Ringen anzuordnen, wobei man deutsche und gegnerische Soldaten getrennt in zwei benachbarten Ringanlagen beisetzte, die dem Gelände entsprechend abgestuft und durch Treppen verbunden wurden (Abb. 1 und 2).
1 Orientierungsplan des Saarbrücker Ehrenfriedhofs (vom Autor überarbeitete Vorlage des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe Saarbrücken)
2 Ehrenfriedhof Saarbrücken, deutsche Ringanlage um 1916, Grundriss, Entwurf: Wilhelm Meyer (reprod. nach: Die Gartenwelt 21 (1917), Nr. 19, S. 217)
[8] "Die Gefallenen verkörpern auch noch in ihren Gräbern, die ringartig um einen Mittelpunkt sich lagern, den feldgrauen Wall, den sie mit ihren lebendigen Leibern einst um das teure Vaterland, um die deutsche Heimat geschlossen hatten", deutete der zuständige Militärpfarrer die Ringform.12 Inwieweit neben dem trauernden Gedenken eine solche nationalistische Konnotation bei der Planung eine Rolle spielte, lässt sich anhand des – vor allem im Stadtarchiv und in der Friedhofs- sowie Bauverwaltung Saarbrückens – überlieferten Quellenmaterials allerdings schwerlich beurteilen. Die Beisetzung gegnerischer Gefallener in direkter Nachbarschaft relativiert jedenfalls den nationalistischen Impetus. Wesentlich war zunächst, als Ausdruck der Dankbarkeit, der Wunsch nach einer besonderen Ehrung der Gefallenen, die man mit einer "würdigen", "stimmungsvollen" Gestaltung "mit einheitlicher und harmonischer Wirkung", so auch später wiederholte Forderungen, verband. Demgemäß erhielt jeder Ring eine dichte Koniferenumpflanzung, jedes Grab eine Efeueinfassung und Rosen. Wenngleich die Gräberbepflanzung heute schlichter ist und die Strauchhinterpflanzungen fehlen, zeichnet sich der Ehrenfriedhof nach wie vor durch reiche Vegetation aus. Zudem beschatten ausgewachsene Bäume das Terrain und verleihen ihm einen hainartigen Charakter (Abb. 3).
3 Ehrenfriedhof Saarbrücken, Blick aus der deutschen Ringanlage nach Nordosten (Foto: Autor)
[9] Was die Anlageform angeht, erscheint es müßig, nach Vorbildern zu suchen, stellen doch Rondelle vielfach bereits Elemente in barocken Gartenanlagen dar – was ebenso im Städtebau für Rundplätze mit zentralen Denkmälern gilt. Auf Friedhöfen gibt es Rondelle schon im Frühklassizismus, etwa als Mittelpunkt beim berühmten "Neuen Begräbnisplatz" in Dessau (1787). Auf den großen Zentralfriedhöfen des 19. Jahrhunderts findet man sie in vielen Variationen. Das Motiv und seine variable Einsetzbarkeit waren also geläufig. Gleichwohl spiegeln diverse Elemente beim Saarbrücker Ehrenfriedhof Prinzipien wider, die erst wenig später von den staatlichen Beratungsstellen propagiert wurden, so die Wahl eines einfachen geometrischen Grundrisses mit klar ausgebildetem Zentrum, die regelmäßige Anordnung der Gräber sowie die räumliche Abgrenzung der Anlage durch Bepflanzung. Hinsichtlich der Bauaufgabe mögen diese Ideen nahe gelegen haben. Viele während des Kriegs gestaltete Ehrenfriedhöfe entsprachen jedoch noch keineswegs den Vorgaben der Beratungsstellen.13
[10] Natürlich finden sich Vergleichsbeispiele, so der Ehrenfriedhof in Barmen von 1914 nach Entwurf von Stadtbauinspektor Richard Lipp in Form eines Kirchengrundrisses mit Rondell im "Chor" oder der ovalförmige Ehrenfriedhof auf dem Stadtfriedhof Celle vom Kölner Gartenarchitekten Nussbaum, der allerdings erst gegen Kriegsende entstand.14 Lurz nennt Beispiele in Frankreich und Südbelgien.15 Das Rondell, meist mit zentralem Denkmal, blieb für Ehrengrabanlagen – gleich ob politisch motiviert oder berufsgruppenspezifischer Natur – im 20. Jahrhundert beliebt, nur beispielhaft sei die 1951 erneuerte Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde genannt. Für die deutschen Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkriegs konstatiert Lurz eine Vielfalt von Grundrissformen, neben Kreisen auch Rechtecke und axiale Anlagen. Dabei wurde häufig "das geometrische Schema nur soweit konsequent verwirklicht, wie es nötig war, um den Friedhöfen ein klares Zentrum zu geben und ihre Binnenstruktur zu gliedern." Die Genese des Saarbrücker Ehrenfriedhofs deckt sich mit diesem Befund.
Funktionsausweitung des Ehrenfriedhofs
[11] Im Zentrum der Gräberringe geplante Denkmale kamen nicht zur Ausführung.16 Deutsche Soldaten bestattete man nach Vollbelegung der Ringanlage noch in einem Erweiterungsfeld. Zudem integrierte man ein Feld für Opfer von Fliegerangriffen17 in die Anlage und – erstaunlicherweise – einen Teil für Veteranen von 1870/71 (s. u.). Muslimische Soldaten der französischen Besatzungsmacht bestattete man noch bis 1921 in einem separaten Feld neben der Ringanlage der Alliierten. Der Ehrenfriedhof erhielt somit über die Gefallenenbestattung hinausgehende Funktionen, war also Gefallenen- und Lazarettfriedhof, Alliiertenfriedhof, Luftkriegsopferfriedhof, Veteranenfriedhof und Friedhof für Besatzertruppen. Bis April 1919 wurden hier 506 deutsche und 223 ausländische Soldaten beigesetzt. Im September 1921 gab es 853 Gräber, deren Zahl sich durch spätere Überführungen aber wieder um etwa 100 verringerte.18
Die Saarbrücker "Vorschriften über die Errichtung von Grabmalen auf dem Ehrenfriedhof" – ein frühes Beispiel konkreter Gestaltungsvorschriften für Kriegergrabmale
[12] Wie die Form der Kriegerfriedhöfe wurde auch die Gestaltung der Kriegergrabmale reichsweit erörtert, was ebenso in zahlreichen Publikationen und Wettbewerben Niederschlag fand.19 Der zeitgenössischen Diskussion zufolge sollten die Kriegergräber "grundsätzlich in ihrer Eigenart erkennbar" sein. Empfohlen wurde, bei jeder Gräberanlage eine typische Grabmalform einheitlich durchzuführen. Gefordert wurde eine einfache, klare, monumentale Form, die dem Gedanken des Todes für das Vaterland am besten entspräche, außerdem eine mäßige Höhe sowie Materialeinheitlichkeit.
[13] Bereits im Frühjahr 1915 erließ die Saarbrücker Verwaltung "Vorschriften über die Errichtung von Grabmalen auf dem Ehrenfriedhof".20 Sie bestimmten ein Genehmigungsverfahren und gaben Richtlinien für Material- und Formwahl sowie Größe, bis 150 cm Höhe, vor. Besonders geeignete Materialien waren wetterbeständige Steinarten wie "Muschelkalk und Granit in gestockter Bearbeitung", außerdem "farbig gehaltene Schmied[e]eisen", bemalte Hölzer und Bronzeguss in Verbindung mit Stein. Bestimmt wurde ferner: "Es darf kein zu großer Wechsel der Grabmalformen stattfinden. Diese müssen je nach ihrer Lage eine künstlerische Einheit bilden und gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen, so dass einheitliche Gruppen entstehen." Damit spiegelten die Vorschriften, die im deutschlandweiten Kontext als frühes Beispiel konkreter Gestaltungsvorschriften für Kriegergrabmale gelten dürfen, die zeitgenössische Diskussion recht prägnant wider.
Rezeption friedhofsreformerischer Ideen
[14] Letztlich waren es Ideen der sogenannten "Friedhofs- und Grabmalreform" im frühen 20. Jahrhundert, die nun auf die Aufgabe Kriegerfriedhof stießen.21 Der Münchner Baubeamte und bedeutende Friedhofsplaner Hans Grässel, ein führender Kopf dieser Reformbestrebungen, hatte 1907 Grabmalvorschriften für den Münchner Waldfriedhof aufgestellt, in denen Vorgaben zu Gestalt, Größe und Materialität der Grabmale gemacht wurden. Dem Vorbild Münchens folgend erarbeiteten zahlreiche Kommunen in den nächsten Jahren ähnliche Vorschriften für ihre Zivilfriedhöfe, 1911 auch Saarbrücken.22 Ziel war eine verbesserte Grabmalgestaltung, die sich gegen die als sinnentleert und als zu pompös empfundenen Gründerzeitgrabmale und den darin manifestierten sozialen Unterschieden und zugleich gegen zunehmende industrielle Massenprodukte im Grabmalschaffen richtete. Gleichzeitig strebte man damit eine ästhetisch anspruchsvolle Ein- bzw. Unterordnung der Grabmale in die Friedhofsanlage an, um den Gemeinschaftsbezug stärker sichtbar zu machen und auch ein attraktiveres wie würdevolleres und zugleich Trost spendendes Erscheinungsbild zu gewinnen. Diese Ziele übertrug man nun auf die Gestaltung der Gefallenenfriedhöfe und -gräber:23 einfache, klare Grabzeichen, das Hervorheben der Gemeinschaft durch einheitliche und harmonische Gesamtwirkung – nun noch wesentlicher als im Zivilfriedhof angesichts des gemeinsamen Kampfes und Todes der Soldaten – sowie eine besondere Würde, mit der sich Dank und Gedenken der Überlebenden und Hinterbliebenen verband.
[15] Parallel zu den Vorschriften legte das Saarbrücker Hochbauamt Musterentwürfe für Grabmale vor.24 Für Mannschaftsgräber wurden kleine variierende Kreuzformen und Stelen in Holz, Stein und Schmiedeeisen vorgeschlagen (Abb. 4), für Offiziersgräber steinerne Stelen mit kissenartigen oder karniesbogig geschweiften Abschlüssen, stilistisch zwischen Klassizismus und geometrischem Jugendstil oszillierend.
4 Grabmale der Mannschaftsgräber in Holz und Schmiedeeisen für den Saarbrücker Ehrenfriedhof, Musterentwürfe des Städtischen Hochbauamts, 26.4.1915. Stadtarchiv Saarbrücken, G 4465 (© Stadtarchiv Saarbrücken)
Gestalterische Anregungen lieferten dabei aktuelle Musterentwürfe für zivile Grabmale, wie sie sich in Grabmalausstellungskatalogen der Vorkriegszeit finden.25 Man adaptierte die Form und ergänzte beispielsweise das Eiserne Kreuz. Vergleichbare Entwürfe finden sich dann auch in Veröffentlichungen zum Thema Kriegergrabmal, die allerdings meist erst später, also nach Frühjahr 1915, erschienen – unter anderem auch von Hans Grässel, dessen Entwürfe 1914 bis 1916 auf dem Münchner Waldfriedhof ausgeführt wurden.26
[16] In Saarbrücken wurden die Musterentwürfe jedoch nur bei wenigen Grabmalen umgesetzt. Während der Kriegszeit erhielten viele Gräber zunächst provisorische Holzkreuze, die die Kriegsbeschädigten-Fürsorge des ansässigen XXI. Armeekorps fertigte. Dieser ephemere Erscheinungszustand ist in Fotos dokumentiert. Er wirft auch die Frage nach dem ursprünglichen, frühen Aussehen anderer Gefallenenfriedhöfe auf. Entwürfe für die Kreuze lieferten neben der städtischen Friedhofs- bzw. Bauverwaltung auch die Hersteller der Kreuze selbst. Dabei orientierte man sich an den Saarbrücker Musterentwürfen von 1915 sowie aktuellen Veröffentlichungen, ebenso aber auch an Gefallenenfriedhöfen an der Front, die eigens hierfür aufgesucht wurden. Die Gräber der deutschen Soldaten erhielten variierende Grabzeichen, die vom lateinischen Kreuz abgeleitet waren, meist eine Verdachung trugen und aufwendig bemalt waren. In manchen Abschnitten entstand hierdurch eine Formen- und Farbvielfalt, die als unangemessen empfunden auch auf heftige Kritik stieß. "Das Gewollte, durch vornehme Einfachheit ein ruhiges und würdevolles Bild zu schaffen, kann dadurch nicht erreicht werden", monierte 1917 ein Architekt des Hochbauamts und verwies auf die Gräber der gegnerischen Kriegstoten, deren gleichmäßige Grabzeichen ein sehr gutes Bild abgäben.27 Franzosen erhielten zum Beispiel einheitlich einfache Kreuze mit hellem Anstrich, Russen doppelarmige Kreuze in gleicher Höhe.
[17] In den 1920er Jahren ließ die Verwaltung die Kreuze durch witterungsbeständigere normierte Steinmale ersetzen, kleine Stelen mit variierenden Abschlüssen nach Entwurf des Hochbauamts. Unter Berücksichtigung der im Saargebiet herrschenden "besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse" gewährte das Zentral-Nachweiseamt für Kriegerverluste und Kriegergräber (Berlin) hierfür Zuschüsse.28 Die Normstelen entsprachen weitgehend Vorgaben, die die staatlichen Beratungsstellen für Kriegerehrungen unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Notlage der Nachkriegszeit propagierten.29
Individuelles Gedenken durch private Grabmalsetzungen
[18] Im deutschen Teil des Ehrenfriedhofs kam die Verwaltung Hinterbliebenen vielfach bei der Platzwahl für die Gräber der Gefallenen entgegen. Dadurch wurden auch Offiziere mitten unter Mannschaften beerdigt. Die ursprünglich intendierte Trennung kam kaum zum Tragen. Angehörige konnten zudem, schon während des Kriegs, ihren Gefallenen Grabmale setzen und machten vielfach Gebrauch von dieser Möglichkeit. 100 Grabmale im deutschen Teil, mehr als 20 Prozent, sind privat gesetzte (Abb. 5). Das Motiv der persönlichen Erinnerung erhielt damit starkes Gewicht.30
5 Ehrenfriedhof Saarbrücken, deutsche Ringanlage mit Fliegeropferfeld und Veteranenfriedhof, Belegungs- und Strukturplan 2008, "individuelle" Grabmale sind violett markiert (vom Autor überarbeitete und ergänzte Vorlage des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe Saarbrücken)
[19] Die privat errichteten Grabmale sind größer und aufwendiger gestaltet als die normierten (Abb. 6).
6 Ehrenfriedhof Saarbrücken, individuelle und normierte Grabmale im nordöstlichen Teil des dritten Ringes der deutschen Ringanlage (Foto: Autor)
Einige stammen von namhaften Architekten und Bildhauern. Vorherrschender Grabmaltyp ist die Stele, häufig mit plastisch verzierter Schauseite. Neben Wappen und Berufszeichen finden sich natürlich vielfach auch militärische Symbole, Embleme mit Helm, Schwert, Eichen-, Lorbeer- oder Palmzweig, Lorbeer- und Eichenlaubkränze sowie das Eiserne Kreuz. Geflügelte Propeller oder Adler mit ausgebreiteten Schwingen bezeichnen die Grabmale von Piloten. Ein Maschinengewehr, ebenso figürliche Darstellungen nehmen Bezug auf die Regimentsgattung – etwa ein nackter Heroe mit Fahne bei einem Fahnenjunker oder ein berittener Ulan wie am Bildstock für den Ulanen Rudolf Braun (Abb. 7).
7 Individuelle Gestaltungen im Saarbrücker Ehrenfriedhof: Grabmale Braun, Peusquens, Neufang und Becker (v. l.) (Fotos: Autor)
Hierbei handelt es sich übrigens um eine typologisch singuläre Grabmalform im Ehrenfriedhof. Entwerfer war ein Kamerad Brauns, der später berühmte Architekt Emil Fahrenkamp, damals Lehrer an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf.31 Auch jüdische Soldaten wurden im Ehrenfriedhof beigesetzt. Ihre Grabmale weisen zum Teil hebräische Inschriften auf, dominierendes Symbol ist der Davidstern.
[20] Das Motiv der persönlichen Trauer erfährt eine außergewöhnliche Umsetzung am Grabmal von Maximilian Peusquens, das der Bübinger Bildhauer Paul Rühling nach Entwurf des Saarbrücker Architekten Ludwig Nobis geschaffen hat.32 Eine an attischen Grabreliefs orientierte Abschiedsszene in Form eines Dreifigurenreliefs – der bewaffnete Sohn verabschiedet sich von den Eltern – offenbart starken familiären Bezug. Entlehnt ist das Abschiedsmotiv dem zivilen Grabkult, der es seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem eigenen Thema gemacht hatte. Daneben kann der bewusste Archaismus auch, noch ganz in gründerzeitlicher Tradition, als Ausweis bürgerlicher Bildung und damit Repräsentation der Hinterbliebenen, in diesem Fall der Familie eines Hüttendirektors, gewertet werden. Letzteres gilt auch für das Offiziersgrabmale der Befreiungskriege rezipierende Denkmal, das der bekannte Saarbrücker Bierbrauer Oskar Neufang seinem Sohn Richard setzen ließ, ein von einem antiken Helm bekrönter Pfeiler.
[21] Christliche Darstellungen zeigen unter anderem den Erzengel Michael, Führer und Schutzheiliger der deutschen Heere, oder, als irdisches Abbild, den heiligen Georg zu Pferde über dem besiegten Drachen, der auch auf die Regimentsgattung – Dragoner – hinweist. Als Urtyp des christlichen Helden und Kriegers und Patron aller Streiter in Christi Namen, speziell der Reiterei, steht der heilige Georg für die Einheit von Soldatentum und christlichem Glauben.33 Dementsprechend wurde der Bildtypus in den 1920er Jahren von kirchlicher Seite aus verstärkt gefördert. Beispiele finden sich etwa in den Jahresmappen der "Deutschen Gesellschaft für Christliche Kunst". Das ins Christliche gewendete Kriegergedenken hängt auch mit der Bewältigung der schweren Niederlage zusammen, die am Ende des Kriegs stand. Der fehlende, dem Soldatentod Sinn gebende Sieg erforderte eine Umdeutung des Gefallenengedenkens, das sich nun mitunter stärker in den religiösen Raum zurückzog.
[22] Bedingt durch die Niederlage ist der "Heldentod" auch in den Inschriften der privat gesetzten Grabmale kaum Thema. Nur wenige Inschriften lassen das Motiv anklingen, etwa die am genannten Grabmal des Ulanen Braun: "Er gab sein junges Leben für sein Vaterland", wobei es sich aber um Grabmale handelt, die noch während des Kriegs entstanden. Zudem sind die Inschriften der privaten Grabmale oft ausführlicher als die der normierten. Neben Namen, Dienstgrad, Regiment und Lebensdaten werden Zivilstatus oder Beruf – "stud. jur.", "Gerichtsreferendar", "Bautechniker" –, ebenso Auszeichnungen, Kriegsverletzungen, Geburts- sowie Sterbeort benannt. Und nicht selten werden Familienbezüge gegeben, in denen sich persönliche Trauer äußert, etwa wenn es heißt: "Mein lieber Gatte. Nie werden wir dich vergessen" oder auch einfach "Unser einziger Sohn".
Individuelles Gedenken an Kriegergrabmalen als lokale Tradition
[23] Die besondere Gewichtung der persönlichen Erinnerung durch die privat gesetzten Grabmale ist, neben Form und Bepflanzung, prägend für das Erscheinungsbild des Ehrenfriedhofs. Dieses "individualisierte" Gepräge ist offenbar vor allem bei frühen, kurz nach Kriegsausbruch ausgeführten Anlagen zu finden, was einerseits mit den noch fehlenden Gestaltungsrichtlinien wie auch mit noch ungeklärten Finanzierungsfragen zusammenhängen mag. In Saarbrücken bezeugt es zudem eine enge Verzahnung von Militär und bürgerlicher Gesellschaft,34 welche hier nach 1871 durch Einrichtung mehrerer Militär-Brigaden und -Inspektionen kontinuierlich gewachsen war und erst mit der Niederlage 1918 abbrach.
[24] Eine weitere Inspirationsquelle kommt hinzu: Das Ehrental, ein etwa zwei Kilometer nordöstlich, heute im Deutsch-Französischen Garten gelegener Soldatenfriedhof aus dem Krieg 1870/71, der nach der Schlacht von Spichern am 6. August 1870 angelegt worden war (Abb. 8).35
8 Gräberreihe im Saarbrücker Ehrental (Foto: Autor)
Diese Begräbnisstätte hatte man zunächst auch im Blick, als man 1914 mit der Einrichtung des neuen Ehrenfriedhofs begann: Die Anlage sollte nämlich "in derselben würdigen Weise erfolgen, wie das Ehrental".36 Auch im Ehrental ruhen deutsche und gegnerische Soldaten nebeneinander. Auch hier durften Angehörige Grabmale setzen, wodurch persönliches Gedenken in den Vordergrund treten konnte. Das hierdurch sehr heterogene Erscheinungsbild des Ehrentals ist kaum militärisch-kriegerisch bestimmt, sondern erscheint gestalterisch an zivile Begräbnisstätten angenähert – allerdings fehlten Regelungen und Prinzipien zur Anlage von Militärfriedhöfen damals noch völlig. Der Ehrenfriedhof des Ersten Weltkriegs setzt also mit der Mischung von öffentlich-militärischem und privatem Gedenken gewissermaßen die "Tradition" des Ehrentals von 1870 fort.
Exzeptionell: Ein Friedhof für Veteranen von 1870/71 im neuen Ehrenfriedhof
[25] Und so ist auch die Anlage eines Friedhofs für Veteranen von 1870/71 noch während des Ersten Weltkriegs zu erklären – eine möglicherweise sepulkral- wie kunstgeschichtliche Einmaligkeit in Deutschland. Der Veteranenfriedhof übernahm nämlich die Funktion des Ehrentals von 1870, welches ab 1885 auch für Beisetzungen von Veteranen gedient hatte und nun nicht mehr erweitert wurde. Das mit Rasen bepflanzte Halbrund mit zentraler Taxus-Allee wurde den Ringanlagen des neuen Ehrenfriedhofs mittig angehängt und ab 1918 noch bis 1937 belegt (Abb. 9).
9 "Kriegerfriedhof für die Feldzugteilnehmer von 1870-71 zu Saarbrücken", Vogelschau, Entwurf: Wilhelm Meyer, Januar 1916 (reprod. nach: Die Gartenwelt 21 (1917), Nr. 17, S. 196)
Die Grabmale, überwiegend schlichte Stelen mit unterschiedlichen, vor allem rundbogigen Abschlüssen, in variierenden Maßen und Materialien, sind in ihrer schlichten Formgebung offensichtlich angeregt von betreffenden Veröffentlichungen zur Ehrung der Gefallenen des Weltkriegs. Häufigstes Motiv ist hier das Eiserne Kreuz, mehrfach im Lorbeerkranz und teilweise, als Rückbezug auf die Monarchie, mit Krone und einbeschriebenem "W" (Wilhelm) versehen.
Der Saarbrücker Ehrenfriedhof – Ein Sonderfall in der deutschen Sepulkralkultur?
[26] Ehrenfriedhofsanlagen mit einem vergleichbaren "individualisierten" Gepräge wie in Saarbrücken lassen sich bislang nur wenige benennen.37 Hierzu zählen die deutschen Gefallenenfriedhöfe des Ersten Weltkriegs auf dem Waldfriedhof Stuttgart, dem Stöckener Friedhof in Hannover, dem Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin, dem Neuen Israelitischen Friedhof in Nürnberg, am Großen Berg in Mülheim, in Aachen (neben dem später eröffneten Waldfriedhof) sowie auf den Hauptfriedhöfen in Karlsruhe, Marburg, Freiburg im Breisgau oder im regionalen Umfeld derjenige in Völklingen.38 Bei den meisten der genannten Beispiele gibt es aber keine Durchmischung, sondern die Feldabschnitte mit normierten und solchen mit individuell gestalteten Grabmalen sind klar getrennt und letztere teilweise den Offiziersgräbern vorbehalten. Gleichwohl legen diese Beispiele nahe, dass die besonderen politischen Verhältnisse im Saargebiet offenbar kaum Auswirkungen hatten auf die Genese der beschriebenen Eigenarten des Saarbrücker Ehrenfriedhofs, sieht man einmal von dem muslimischen Grabfeld der Besatzungsmacht ab.
[27] Deutschlandweit häufiger zu finden sind individuelle bzw. nicht normierte Grabmalgestaltungen bei Kriegergräbern, welche vereinzelt oder in kleinen Ehrenfeldern innerhalb von Friedhöfen kleiner Ortschaften angelegt wurden.39 Auch im Ausland gab es, vor allem auf deutschen Gefallenenfriedhöfen im französischen Frontgebiet, vielfach von Angehörigen oder Kameraden gesetzte "individuelle" Grabmale. Nicht selten mussten sie in der Nachkriegszeit einer vereinheitlichenden Neugestaltung durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge weichen, etwa in Brieulles, Lille oder Laon.40
[28] Der tatsächliche Seltenheitscharakter solcher Anlagen lässt sich angesichts der existierenden Vielzahl von Ehrenfriedhöfen derzeit kaum einschätzen. Im Verlauf des Kriegs und dann weitgehend in der Nachkriegszeit ging man jedoch zunehmend dazu über, alle Gräber einheitlich anzulegen, was auch einherging mit einem Abbau der Rangunterschiede im Ehrenfriedhof. Den hiervon abweichenden Anlagen kommt daher mit ihren individuellen Grabmalen über ihren Seltenheitswert und ihre allgemeine Aussage als Gefallenenfriedhof hinaus auch als künstlerische, kunsthistorische und sozialgeschichtliche Zeugnisse besondere Bedeutung zu, zumal in der Nachkriegszeit auch im Inland vielerorts Ehrenfriedhöfe vereinheitlichend überformt wurden – mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus meist im Dienste einer stärkeren politischen Funktionalisierung, für die solche Anlagen wie in Saarbrücken nur schwerlich taugten. Die Nationalsozialisten suchten nämlich die in der Gefallenenehrung latent vorhandenen Elemente Heldentum sowie Kampf- und Opferbereitschaft im Dienst nationalistisch-militaristischer Intentionen wieder zu verstärken und stellten damit andere Forderungen an die Gestaltung von "Heldenfriedhöfen", als das in der unmittelbaren Nachkriegszeit der Fall gewesen war.41 Entsprechend urteilte Werner Barkenowitz, seit 1932 Saarbrücker Stadtgartendirektor, 1936, ein Jahr nach der Rückgliederung des Saargebietes an das Deutsche Reich, harsch: "Bedauerlich auch die Gestaltung des Ehrenfriedhofs. Keine beherrschende, wuchtige, monumentale Gesamtanlage, sondern unübersichtlich, wie ein Irrgarten, jeder Bodenfalte folgend, gibt er keine Gestaltung des unerschütterlichen Blockes unseres gewaltigen Frontheeres, sondern verzettelt dieses in kleinste Einzelräume. Spätere Geschlechter, wenn wir nicht mehr dazu kommen, werden hier so gewiss einmal eine Umgestaltung vornehmen."42 Dass es dazu doch nicht gekommen ist, kann, wie vorstehende Ausführungen nahelegen, aus heutiger Sicht gewissermaßen als Glücksfall angesehen werden.
Gastherausgeber des Special Issues
Christian Fuhrmeister und Kai Kappel (Hg.), War Graves, War
Cemeteries, and Memorial Shrines as a Building Task, 1914-1989. Die
Bauaufgabe Soldatenfriedhof/Kriegsgräberstätte zwischen 1914 und 1989,
in: RIHA Journal 0150-0176
Lizenz
The text of this article is provided under the terms of the
Creative
Commons License CC-BY-NC-ND 4.0
1 Der Autor hat den Ehrenfriedhof im Rahmen seiner Dissertation umfassend untersucht: Rainer Knauf, Zivile und militärische Friedhofs- und Grabmalgestaltung im 20. Jahrhundert. Der Saarbrücker Hauptfriedhof 1912-1959, Saarbrücken 2010, hier 83-166. Die Studie bildet, ergänzt um neuere Erkenntnisse, die Grundlage der folgenden Ausführungen.
2 Paul Clemen, "Südbelgische Kriegerfriedhöfe", in: Deutsche Bauzeitung 62 (1928), 111-112, hier 111.
3 Auf dem Heidelberger Bergfriedhof sind noch Grabmale eines 1849 mit 74 Soldaten belegten Feldes erhalten, siehe Leena Ruuskanen, Der Heidelberger Bergfriedhof, Heidelberg 1992, 93-95. Beispiele für Kriegergräber und -friedhöfe aus den deutsch-dänischen Kriegen bei Gerd Stolz und Heyo Wulf, Dänische, deutsche und österreichische Kriegsgräber von 1848/51 und 1864 in Schleswig-Holstein, Husum 2004. Nach George L. Mosse entstanden auch kleine Soldatenfriedhöfe "als Zufallsprodukte während der Deutschen Befreiungskriege": "Soldatenfriedhöfe und nationale Wiedergeburt. Der Gefallenenkult in Deutschland", in: Kriegserlebnis. Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und symbolischen Deutung der Nationen, hg. v. Klaus Vondung, Göttingen 1980, 241-261, hier 249. Peter Jessen (Schriftleitung), Kriegergräber im Felde und daheim, München 1917 (= Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1916/17), Tafel 155 zeigt einen Kriegerfriedhof von 1813 im Zillertal.
4 Norbert Fischer, "Zwischen Kulturkritik und Funktionalität. Die Friedhofsreform und ihr gesellschaftlicher Kontext in Deutschland 1900-1930", in: Vom Reichsausschuss zur Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, hg. v. Reiner Sörries, Kassel 2002 (= Kasseler Studien zur Sepulkralkultur, 9), 9-21, hier 14. Zur diesbezüglichen Entwicklung in Österreich-Ungarn Thomas Reichl, Das Kriegsgräberwesen Österreich-Ungarns im Weltkrieg und die Obsorge in der Republik Österreich. Das Wirken des Österreichischen Schwarzen Kreuzes in der Zwischenkriegszeit, Diss. Wien 2007.
5 Ausführlich hierzu Knauf, Zivile und militärische Friedhofs- und Grabmalgestaltung im 20. Jahrhundert, 87-95.
6 Vorgang in StA Sbr., G [= Stadtarchiv Saarbrücken, Best. Großstadt] 5490, 47-48.
7 Willy Lange, Deutsche Heldenhaine, Leipzig 1915. Veröffentlichungen und Stellungnahmen hierzu aus den Jahren 1915-1917, u. a. der Rheinischen Beratungsstelle für Kriegerehrungen, der Arbeitsgemeinschaft für Deutschlands Heldenhaine und der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, sowie Langes Schrift Heldeneichen und Friedenslinden in StA Sbr., G 5490. Siehe auch George L. Mosse, Gefallen für das Vaterland. Nationales Heldentum und namenloses Sterben, Stuttgart 1993, 109-112; Ders., "Soldatenfriedhöfe und nationale Wiedergeburt", 254-256; Meinhold Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, 6 Bde., Heidelberg 1985-87, hier Bd. 3, 98.
8 Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 3, 78.
9 Mitteilungen der Zentralstelle des Deutschen Städtetages V, Nr. 6 (1915) 161-162, zit. nach Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 3, 33-34.
10 Zu den lokal differierenden Beerdigungspraktiken und zur anfänglichen Unsicherheit, ob Massengräber oder Einzelgräber anzulegen seien, siehe Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 3, 31. Bei den Deutschen wurde das Einzelgrab für Gefallene rasch zur Norm und auch die anderen kriegführenden Staaten Europas gingen während des Weltkriegs zur individuellen Beisetzung der Gefallenen über, welche bis dahin vor allem Offizieren vorbehalten gewesen war. Dabei spielten die Einführung von Erkennungsmarken und die Ermöglichung von späteren Rücküberführungen eine wichtige Rolle.
11 Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 3, 54.
12 Müller (Konsistorialrat), "Saarbrückens Ehrenfriedhof", in: Saarbrücker Zeitung, 9.6.1916.
13 Vgl. hierzu Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 3, 55 u. 75, mit Beispielen.
14 [o. A], "Ehrenfriedhof der Stadt Barmen", in:Zentralblatt der Bauverwaltung 34 (1914), 702-703; http://www.wuppertals-gruene-anlagen.de/friedhofe/ehrenfriedhof-barmen/ (aufgerufen am 12. Dezember 2015); Th[eodor] Nussbaum, "Der Kriegerehrenfriedhof der Stadt Celle", in: Die Gartenkunst 32 (1919) Nr. 4, 41.
15 Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 3, 115. Ebd. nachfolgendes Zitat.
16 In StA Sbr., G 4465 sind Ideenskizzen für ein Denkmal in Form eines Monopteros überliefert.
17 Während des Ersten Weltkriegs starben bei 18 Fliegerüberfällen auf Saarbrücken insgesamt 58 Menschen, siehe Verzeichnis in StA Sbr., G 3256.
18 Listen und Vorgänge in StA Sbr., G 4468, 4471, 4474, 4477.
19 Siehe z. B. Hans Grässel, "Über Kriegerehrungen", in: Bayerischer Heimatschutz 1916 (Sonderheft Krieg und Heimat), 93-96, hier 93, und die Bibliografie bei F. W. Bredt, Friedhof und Grabmal, Düsseldorf 1916 (= Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz, 10), 162-163.
20 Vorgang in StA Sbr., G 4465.
21 Grundlegend zur "Friedhofsreform" in Deutschland: Sörries, Vom Reichsausschuss zur Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Siehe u. a. auch Helmut Schoenfeld, "Soldatenfriedhöfe. Ihre Entwicklung und ihr Einfluß auf die Friedhofsreform des 20. Jahrhunderts", in: Nekropolis: Der Friedhof als Ort der Toten und der Lebenden, hg. v. Norbert Fischer und Markwart Herzog, Stuttgart 2005 (= Irseer Dialoge, 10), 95-106, hier 100-101; Norbert Fischer, Vom Gottesacker zum Krematorium. Eine Sozialgeschichte der Friedhöfe in Deutschland, Köln/Weimar/Wien 1996, 75-83.
22 Begräbnisordnung für die Friedhöfe der Stadt Saarbrücken vom 3.5.1911.
23 Bezeichnenderweise waren es teilweise dieselben Kräfte, u. a. eben Hans Grässel, die sich nun der Gestaltung von Kriegerfriedhöfen und -gräbern widmeten und mit ihren hierbei entwickelten Ideen quasi rückkoppelnd auch die Durchsetzung der Friedhofsreformbestrebungen im Bereich der Zivilfriedhöfe zu beschleunigen suchten, vgl. u. a. Schoenfeld, Soldatenfriedhöfe, 102-106; Norbert Fischer, "Der uniformierte Tod. Soldatenfriedhöfe", in: Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstraßen der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, hg. v. Reiner Sörries, Braunschweig 2003, 255-264, hier 262-263; Ders., "Zwischen Kulturkritik und Funktionalität", 14.
24 Enthalten in StA Sbr., G 4465.
25 Vor allem für die in Saarbrücken entworfenen hölzernen und teilweise auch die schmiedeeisernen Grabzeichen finden sich vergleichbare Gestaltungen z. B. im Katalog: Karl Wilde, Hg., Grabmalkunst. Eine Auswahl vorbildlicher Entwürfe für Reihengräber. Zugleich ein Führer durch die Grabmalkunst-Ausstellung auf dem neuen Frankfurter Hauptfriedhofe, Frankfurt am Main 1910.
26 Siehe Jessen, Kriegergräber im Felde und daheim, Tafeln 44-45.
27 Bericht von Architekt Fuchs, 30.5.1917, in StA Sbr., G 4466.
28 Bescheid des Zentral-Nachweiseamts für Kriegerverluste und Kriegergräber, 24.8.1921, in StA Sbr., G 4477, 104. Das Zentral-Nachweiseamt wurde nach dem Krieg ins Leben gerufen zwecks Vereinheitlichung der inzwischen durch Aufsplitterung der Dienststellen verunklärten Kompetenzen in der Kriegsgräberfürsorge, in welche das politisch abgetrennte Saargebiet offensichtlich miteinbezogen wurde. Allerdings war die staatliche Kriegsgräberfürsorge aus Gründen der Geldknappheit nicht ausreichend, was die von öffentlichem Interesse getragene Gründung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge beförderte, vgl. Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 4, 101.
29 Siehe Kriegergräber. Beispiele einfacher Grabsteine, hg. v. Erich Richter und Franz Seeck, Berlin [1920], Titelzitat nach Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 4, 454, Anm. 335. Siehe auch ebd. 123-124. Zu den normierten Steingrabmalen in Saarbrücken ausführlich Knauf, Zivile und militärische Friedhofs- und Grabmalgestaltung im 20. Jahrhundert, 129-134.
30 Aufgrund ihres sepulkralen Sonderstatus hat der Autor sämtliche dieser Grabmale dokumentiert und gewürdigt, siehe Knauf, Zivile und militärische Friedhofs- und Grabmalgestaltung im 20. Jahrhundert, 134-143 u. 339-352. Hier kann nur ein knapper Überblick gegeben werden.
31 Christoph Heuter, Emil Fahrenkamp 1885-1966. Architekt im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, Petersberg 2002, 26 u. Werkliste 212, Nrn. 23-24.
32 Grabmalantrag mit Schriftverkehr in StA Sbr., G 4466.
33 Manfred Lurker, Wörterbuch der Symbolik, 2. Aufl., Stuttgart 1983, 220-221. LCI Bd. 6, 365-390.
34 Paul Burgard und Ludwig Linsmayer, "Von der Vereinigung der Saarstädte zum Abstimmungskampf (1909-35)", in: Geschichte der Stadt Saarbrücken, hg. v. Rolf Wittenbrock, Saarbrücken 1999, Bd. 2, 131-242, hier 135.
35 Ausführlich zum Ehrental Knauf, Zivile und militärische Friedhofs- und Grabmalgestaltung im 20. Jahrhundert, 154-165, mit weiterer Literatur.
36 StA Sbr., G 4465, Bg. Hobohm an das kgl. Generalkommando des XXI. Armeekorps, 17. August 1914.
37 Auf der Suche nach Vergleichsbeispielen wurden vom Autor bereits 2005 bei der Münchner ICOMOS-Tagung "Der bürgerliche Tod – Städtische Bestattungskultur von der Aufklärung bis zum frühen 20. Jahrhundert" mehrere sich neuzeitlicher Sepulkralkultur widmende Wissenschaftler hierzu befragt, allerdings ohne nennenswerte Ergebnisse. Anfragen bei verschiedenen Stellen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge erbrachten Hinweise auf Mülheim und auf französische Anlagen. Weitere konnte der Autor auf Reisen entdecken. Internetforen, die sich der Suche nach Weltkriegsgräbern widmen und Fotos von Friedhöfen sammeln, ermöglichen Zufallsfunde, doch kommt die hier wachsende Datenmenge gezielten Suchen zunehmend entgegen.
38 Ausführlicher zu den genannten Friedhöfen Knauf, Zivile und militärische Friedhofs- und Grabmalgestaltung im 20. Jahrhundert, 146-154, mit weiterer Literatur. Zu Aachen neuerdings Detlef Sambale (Red.), Aachener Friedhöfe. 100 Jahre Ehrenfriedhof, Aachen 2014.
39 Ein Beispiel im regionalen Umfeld ist das kleine Gräberrondell auf dem Waldfriedhof Saarbrücken-Gersweiler. In einer aktuellen Veröffentlichung für Sachsen-Anhalt finden sich Beispiele unter anderem in den Orten Nedlitz, Kayna, Pabstorf, Leimbach und Trabitz, siehe Die Gräber erhalten, den Frieden bewahren. Gräber für die Opfer des 1. Weltkrieges auf dem Gebiet des heutigen Landes Sachsen-Anhalt, hg. v. Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt (Red. Carola Faust, Lutz Miehe und Martina Neubauer), Magdeburg 2014, 57, 80, 93, 113,126.
40 Historische Fotoaufnahmen der Friedhöfe von Brieulles, Laon und Lens bei Willi Kammerer, Deutsche Kriegsgräberstätten im Westen, Kassel 2001, 109. Zu Laon siehe auch Jessen, Kriegergräber im Felde und daheim, Tafel 15, sowie [o. A.], "Der deutsche Krieger-Friedhof in Laon", in: Deutsche Kunst und Dekoration 38 (1916), 417-420, mit Abb. Der 1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der im Deutschen Reich schnell maßgebende und ausführende Instanz bei der Anlage von Kriegerfriedhöfen wurde, konnte erst 1935, nach der Rückgliederung des Saargebiets zu Deutschland, hier seine Arbeit auf breiter Ebene aufnehmen. Tatsächlich unterhielt der Volksbund aber bereits während der Völkerbundszeit Kontakte zu Gemeinden im Saargebiet, Informations- und Beratungsschriften des Volksbundes lagen den Verwaltungen vor. Welche Wirkungsmöglichkeiten der Volksbund in dieser Zeit im Saargebiet entfalten konnte und wie die Besatzungsmacht dazu stand, ist im Einzelnen noch nicht erforscht. Ein Landesverband Saar des Volksbunds wurde erst 1957 ins Leben gerufen.
41 Hierzu u. a. Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, Bd. 5, 236.
42 StA Sbr., Personalakten Alter Best. 2520 (A. Bundesmann), Mappe Nr. 2/85, 111.