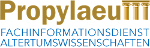Die Jupitersäulen und die übrigen Gattungen der Votivplastik in der Civitas Ulpia Sueborum Nicrensium und ihr Kontext in der provincia Germania superior
Identifier (Artikel)
Abstract
Jupitersäulen gehören zu einer Gattung von Weihgeschenken, die von der zweiten Hälfte des 1. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. für Teile der germanischen und gallischen Provinzen signifikant sind. Seit dem späten 19. Jahrhundert sind sie in der Literatur, insbesondere in Hinblick auf ihre religiöse Bedeutung, vielfach behandelt worden, doch wird auf ihre Forschungsgeschichte hier nur kursorisch eingegangen.
Die Jupitersäulen werden erstmals im Gesamtkontext der Votivplastik, also der Weihaltäre, -reliefs und -plastiken, analysiert, wobei jedoch die Denkmäler der sog. orientalischen Kulte außer Betracht bleiben. Ausgangspunkt bilden die zahlreichen Votive in
der civitas Ulpia Sueborum Nicrensium mit ihrem Hauptort Lopodunum–Ladenburg (Kat. 1.1–1.41; 2.1–2.76). In die Abhandlung einbezogen werden auch Jupitersäulen aus der Germania inferior, aus Gallien, insbesondere der Gallia Belgica, randlich aus Raetien und Britannien (Anhang 3). Bei der Untersuchung der Verbreitung der Säulenvotive wird berücksichtigt, dass die Überlieferung durch Wiederverwendungen und durch ‚Verlochungen‘ in römischen Brunnen und Gruben verzerrt ist. Die verschiedenen Thesen zu ihrer Interpretation werden diskutiert und hier für eine Erklärung der Mehrzahl der Befunde als Zerstörungen bei Bilderstürmen im Zuge der Alamannen- und Frankeneinfälle des 3. und 4. Jahrhunderts und der anschließenden Verfüllungen zwecks Entschuttung des Siedlungsgeländes plädiert. Abgesehen von Mogontiacum–Mainz, dem caput provinciae, erweisen sich in der Germania superior civitas-Hauptorte als Zentren der Verbreitung von Jupitersäulen, gefolgt von weiteren vici der civitates. Nida–(Frankfurt-) Heddernheim und Lopodunum–Ladenburg nehmen mit Abstand die Spitzenpositionen ein. villae rusticae treten – anders als in der Germania inferior – deutlich zurück. In Heiligtümer sind Jupitersäulen kaum geweiht worden. Die Gattung ist jedoch nicht gleichmäßig über das Gebiet der Provinz verteilt, im südlichen Obergermanien ist sie kaum vertreten, in ihrem Norden dünnt das Vorkommen aus.
Für die Chronologie der Jupitersäulen und der anderen Votive haben die inschriftlich datierten Weihedenkmäler als Eckpunkte zu dienen. Nur vereinzelt liefern archäologische Befunde verlässliche Daten. Die Untersuchung kommt daher nicht ohne eine Analyse der stilistischen Entwicklung aus, die sich vornehmlich auf die Reliefs der Hauptsockel, der sog. Drei- und Viergöttersteine, der Säulen zu stützen hat. Die früheste bekannte Jupitersäule ist das um 65 n. Chr. zum Heile des Nero geweihte Monument in Mainz, ihr bekrönender Statuentypus, der repräsentativ stehende Gott, lässt sich vereinzelt bis in das 3. Jahrhundert verfolgen. Das Aufkommen der sog. Jupitergigantenreiter lässt sich für die flavische Zeit wahrscheinlich machen. Hingegen sind die wenigen ebenfalls als Bekrönung von Jupitersäulen dienenden Statuengruppen des Gigantenkämpfers in der Biga erst in das 3. Jahrhundert zu datieren. Diesem Zeitraum gehören auch die bekrönenden Gruppen des thronenden Paares Jupiter–Juno an. Die Statuen des einzeln thronenden Iuppiter Capitolinus, die in Niedergermanien seit dem 2. Jahrhundert die Gattung beherrschen und auch in der Gallia Belgica vorkommen, bleiben im oberen Germanien selten und setzen erst zu Ende des 2. Jahrhunderts ein. Nach den Anfängen der kontinuierlichen Überlieferung der obergermanischen Jupitersäulen in der flavischen Epoche und ihrer Weiterentwicklung im 2. Jahrhundert ist zu beobachten, dass die Masse der Anathemata erst im 3. Jahrhundert in Auftrag gegeben worden ist, dem Zeitraum, aus dem mit einer Ausnahme die durch Konsulatsangabe datierten Monumente stammen. Deutlich weniger Votive entfallen auf das 2. Viertel des 3. Jahrhunderts. In der Mitte des Jahrhunderts ist ein Niedergang an Zahl und bildhauerischer Qualität der Säulenmonumente nicht zu übersehen. Er betrifft gleichermaßen die übrigen Gattungen der obergermanischen Votivplastik, deren Entwicklung in etwa synchron zu der der Säulenvotive verläuft. Bei der Herausarbeitung von Bildhauerwerkstätten werden die hierbei weiterhin bestehenden methodischen Schwierigkeiten thematisiert. Trotzdem kann die von der Forschung bereits erkannte dezentrale Struktur des bildhauerischen Schaffens in der Germania superior bestätigt werden. In ihren civitas-Hauptorten, aber auch in ihren vici sind officinae zu belegen. Selbst in kleineren Siedlungen sind Bildhauerbetriebe nachzuweisen.
Ausführlich wird die Typologie der Jupitersäulen behandelt, für die durch mehrere Inschriften auf ihren Sockeln und auf sog. Stifteraltären die Bezeichnungen columna cum signo und columna cum statua überliefert sind. Anders als in der Literatur vorherrschend wird der Begriff „Jupitergigantensäule“ nur für die Monumente verwendet, die nachweislich eine Statue Jupiters als Gigantensieger trugen. Als Oberbegriff wird von „Jupitersäulen“ gesprochen.
Die Gruppen des sog. Jupitergigantenreiters, die als Bekrönung die Anathemata in Obergermanien und Gallien dominieren, während sie in Niedergermanien deutlich in der Minderzahl bleiben, werden detailliert untersucht. Ihre Beurteilung wird freilich durch die zumeist schlechte Erhaltung der ca. 120 überlieferten obergermanischen Gruppen erschwert (neuere obergermanische Funde Anhang 1), wobei von nur ca. 20 Votiven der Kopf Jupiters erhalten ist.
Die Darstellung des Gigantenkampfes weist ein breites Spektrum an Lösungen dieses für die Bildhauer in den Provinzen schwierig zu gestaltenden Gruppenmotivs auf. Dies wirft die Frage nach ihren Vorbildern auf. Präferiert wird die Hypothese, dass nicht die bekannten Reitergrabsteine der germanischen Provinzen, sondern Herrscherstatuen, die den Triumpf über Barbaren feiern, in Frage kommen.
Relativ günstige Erhaltungsbedingungen bestanden für die blockhaften Sockel der Säulenmonumente, wobei zwischen ‚Hauptsockeln‘ und den häufig hinzugefügten sog. Zwischensockeln zu unterscheiden ist. Für die Hauptsockel hat sich die Bezeichnung „Viergöttersteine“ eingebürgert, doch ist zwischen Blöcken mit Götterreliefs auf allen vier Seiten und solchen mit der Dedikation auf der Front, Götterdarstellungen auf den drei anderen Seiten zu differenzieren: Dreigöttersteine. Etwa die Hälfte der bekannten Hauptsockel weist die Götterkonstellation Juno–Merkur–Herkules–Minerva (bzw. in linksläufiger Leserichtung Juno–Minerva–Herkules–Merkur) auf, was in der deutschsprachigen Literatur zu der irrigen Bezeichnung „Normalreihe“ geführt hat.
Besondere Beachtung verdienen die nicht wenigen obergermanischen Sockel mit der Darstellung der Victoria im Typus Brescia (Anhang 2), häufig kombiniert mit dem Relief des Mars auf der anderen Blockseite. Zusammen mit den gleichfalls obergermanischen Weihestatuen dieses Typus wird die Vermutung entwickelt, dass die Votive ein in Mainz aufgestelltes Staatsdenkmal oder Kultbild, errichtet aus Anlass des Germanensieges des Domitian, reflektieren.
Die Jupitersäulen der Germania superior sind zumeist – anders als in der Germania inferior – in der Tradition des Mainzer Monumentes pro salute Neronis mit dem sog. Zwischensockel versehen. Er trägt auf der Frontseite vorwiegend die Weihinschrift, als Bildschmuck herrschen die sieben Götter der Woche vor, die auf polygonalen oder zylindrischen Sockeln als Ganzfiguren oder weniger häufig als Protomen wiedergegeben sind.
Einige Votive, darunter schon das Mainzer Monument, überliefern die gemeinsame Dedikation von columna und ara. Manche archäologische Befunde bezeugen das gemeinsame Vorkommen von Säulenvotiven und dem I.O.M. gestifteten Altären ohne Erwähnung einer columna Weihung. Problematisch ist es hingegen, mit der Errichtung von Jupitersäulen in der Germanis superior generell die Setzung solcher ‚Stifteraltäre‘ zu verbinden. Hiergegen spricht schon ihre relativ geringe Anzahl.
Als Stützen für die Jupiterstatuen gleich welchen Typs dienen im gesamten Verbreitungsgebiet der Gattung zumeist, jedoch nicht ausschließlich, die fälschlich sog. Schuppensäulen, deren Schäfte mit Blättern, wohl des Lorbeerbaums, umhüllt sind, die ihnen einen sakralen Charakter verleihen. Ein anderer Säulentypus mit vegetabilem Dekor, gleichfalls aus dem gesamten Verbreitungsgebiet bekannt, weist Schäfte mit Rankendekor, insbesondere des Weinstocks auf. Manche Anathemata begnügen sich hingegen mit gänzlich undekorierten Schäften.
Was die Kapitelle der Säulenvotive anbetrifft, so ist das korinthische Figuralkapitell mit Protomen, zumeist der Jahreszeitenpersonifikationen, der bevorzugte, jedoch nicht einzige Typus. Kapitelle korinthischer Ordnung treten deutlich zurück; tuskanische Kapitelle kommen – anders als in der Architektur der Provinz – kaum vor.
Zur Votivpraxis gehören in den Nordwest-Provinzen neben den Jupitersäulen Weihaltäre, zuweilen als ara bezeichnet, Weihreliefs sowie Statuen, in einigen Fällen als signum, simulacrum oder statua angesprochen. Altäre, die mit dem Relief der verehrten Gottheit ausgestattet sind, kommen in Obergermanien – im Gegensatz zur unteren Provinz – relativ selten vor. Dem Bedürfnis nach einem Abbild der Gottheit tragen zahlreiche Weihreliefs Rechnung. Zu ihnen gehören die für die Germania superior eigentümlichen sog. Dreifigurenreliefs, die eine Gottheit: sei es Minerva, Fortuna, Merkur oder Vulcan in das Zentrum rücken, diesen jeweils zwei verwandte an die Seite stellen.
Eines der Anliegen der Studie ist es, die Götterwelt der Jupitersäulen mit der der übrigen Votive Obergermaniens abzugleichen. Sie stimmen nominell und ikonographisch zu einem erheblichen Teil überein, doch erweist sich bei genauer Analyse, dass es sich bei den Votiven für Merkur, Apollo, Mars, Diana teilweise um einheimische Kulte handelt. Es begegnen jedoch auch Gottheiten, die sich auf den Säulenvotiven nicht finden. Neben den sog. orientalischen Gottheiten sind dies Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttinnen, also sitzende Figuren mit Kind oder Früchtekorb auf dem Schoß. Selbiges gilt auch für Epona, die sich in der Provinz erheblicher Beliebtheit erfreute. Im Gegensatz zur Germania inferior finden sich in der oberen Provinz Weihungen an die Matronae sowie Reliefs mit dem bekannten Typus der Dreiheit der thronenden Göttinnen relativ selten, während Epona in der Nachbarprovinz quasi fehlt.
Insgesamt ist festzuhalten, dass für I.O.M. mit erheblichem Abstand vor Merkur die meisten Votive, seien es Säulen, Altäre, Reliefs, Statuen, gestiftet worden sind. Die Maße der Jupitersäulen differieren erheblich. Einige Stiftungen begnügen sich mit ca. zehn Fuß Gesamthöhe, häufiger sind solche von ca. elf Fuß, andere erreichen um die 20 Fuß, monumentale Anathemata erreichen an die 50 Fuß (Jupitergigantensäule von Merten, Moselle, Gallia Belgica). Die Stifter wollten offensichtlich den Gott besonders günstig stimmen und ihr gesellschaftliches Prestige mehren. Indizien für die Wertschätzung der Gattung sind auch die mehrmals bezeugten Wiederherstellungen nach Beschädigungen (renovavit, restituit).
Als Dedikanten treten Militärs deutlich hinter Angehörigen der Zivilgesellschaft zurück. In den übrigen Gattungen der obergermanischen Votivplastik sind Soldaten und Offiziere stärker vertreten. Frauen als Alleinweihende sind lediglich auf vier Votiven der Provinz, darunter eine Jupitersäule, bezeugt. Trotz des erheblichen materiellen Aufwandes für die Errichtung der größeren Säulenvotive handelt es sich nur selten um Weihungen von Personalverbänden.
Zwar ist das hohe Maß an Konformität der Säulenmonumente nicht zu übersehen, doch wurden für ihre Sockel auch selten gewählte Götterkonstellationen in Auftrag gegeben, die auf individuelle religiöse Vorstellungen der Stifter schließen lassen. Berufsbedingte Götterauswahlensind nicht zu beobachten, da kaum Berufe in den Dedikationen angegeben werden.
Auffällig ist die häufige Darstellung von Victoria und von Mars, die an einen militärischen Status ihrer Stifter denken lässt, was jedoch nur in einzelnen Fällen zutrifft. Der Hinwendung der Auftraggeber zu den Dii militares werden daher allgemeinere Motive zu Grunde liegen, etwas das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit in der Grenzprovinz.
Am häufigsten werden auf den Säulenvotiven Juno und Minerva dargestellt, die zusammen mit der bekrönenden Statue Jupiters die Trias Capitolina bilden: Sockelreliefs der sog. Normalreihe sowie ‚Schuppensäulen‘ mit übereinander gestaffelten Reliefs der Gottheiten.
Auch die ebenfalls wiedergegebenden Götter Herkules und Merkur wurden im capitolium Roms verehrt. Capitolia sind in der Germania inferior (CCAA; CVT) und der Pannoniasuperior (Savaria–Szombathely und Scarbantia–Sopron) belegt. Dedikationen oder Bildzeugnisse stammen aus fast allen Nordwest-Provinzen (Britannien, beide Germanien, Raetien, Pannonien, Dacia, Moesia inferior sowie Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis).
Ist damit die Verbreitung des Kultes der Kapitolinischen Dreiheit bei Angehörigen der Militär- wie der Zivilgesellschaft in den Grenzprovinzen gesichert, so liegt die Vermutung nahe, dass zwischen der Verehrung der Trias von Jupiter, Juno, Minerva und den Programmen der einschlägigen Jupitersäulen ein Zusammenhang besteht, die Stifter ihre Verbundenheit mit den Hauptgottheiten des Imperium bekunden, sich ihres Beistandes versichern wollten. Zu betonen ist aber, dass sich die Dedikationen stets an I.O.M oder an I.O.M. et Iuno Regina richten. Mit dem Motiv des im ostgallisch-obergermanischen Raum geschaffenen Jupitergigantenreiters stand ein Statuentypus zur Verfügung, der die keltisch geprägten Vorstellungen vom Himmels- und Wettergott visualisierte und außerordentliche Akzeptanz erfuhr.
Statistiken

Lizenz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.