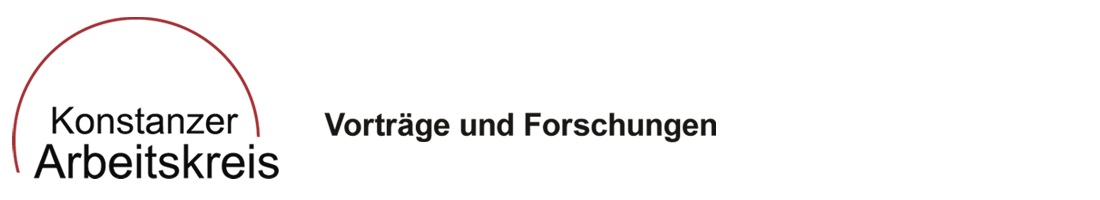Archiv

Adeliges und fürstliches Erben im Reich (ca. 1150–1250). Recht – Praktiken – Aushandlungen
Bd. 98 (2025)
(vorerst nur Inhaltsverzeichnis)
Die Geschichte hochadeliger Herrschaften im Reich zwischen 1150 und 1250 ist dadurch gekennzeichnet, dass diese beim Fehlen eines männlichen Erben in ihrem Bestand bedroht waren. In der Regel war es unmöglich, Lehen und Allodien gesamthaft an Töchter weiterzugeben. Erbstreitigkeiten waren oftmals die Folge, und auch relativ gut etablierte Herrschaften konnten sich auflösen. Die Untersuchung, wie Zeitgenossen mit der »offenen« Situation umgingen, die durch die Abwesenheit eines männlichen Erben geschaffen wurde, ermöglicht vielfältige Einblicke in die politische Kultur des 12. und 13. Jahrhunderts: Sie lassen Formen der Konfliktführung und Aushandlungsprozesse sichtbar werden und zeigen die Handlungsspielräume der beteiligten Frauen. Die Unterschiede im Erbrecht verschaffen zudem Einblicke in die Ausdifferenzierung hochadliger Rangstufen.
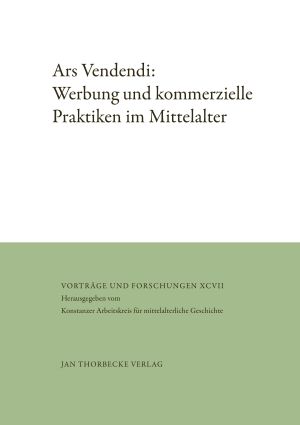
Ars Vendendi: Werbung und kommerzielle Praktiken im Mittelalter
Bd. 97 (2024)
(vorerst nur Inhaltsverzeichnis)
Die »Kunst des Verkaufens« war bereits auf mittelalterlichen Märkten wichtig, da Anbieter und Anbieterinnen von Waren und Dienstleistungen miteinander konkurrierten und ihre Produkte anpriesen. Daher enthalten
archäologische, schriftliche und bildliche Quellen zahlreiche Hinweise auf die Rhetorik und Praktiken des Verkaufens und Werbens: Zur Schau gestellte Waren, Handwerks- und Wirtshauszeichen, Marktschreier und Weinrufer sowie Markennamen, Warenmuster und Buchkataloge dienten sowohl der Information der Konsumentinnen und Konsumenten als auch der Absatzsteigerung. In Traktaten und Predigten wurde über diese Techniken bereits im Mittelalter kritisch oder satirisch reflektiert. Die Autorinnen und Autoren der in diesem Band versammelten Beiträge präsentieren unterschiedliche Facetten dieser mittelalterlichen Ars Vendendi und stellen sie in einen größeren Kontext.

Vorträge und Forschungen: Fürsten und Finanzen im Mittelalter
Bd. 95 (2024)
(vorerst nur Inhaltsverzeichnis)
»Fürsten und Herren […] können nichts erreichen, wenn sie kein Geld haben.« Kaum ein Satz bringt die Motivation und Berechtigung, sich mit »Fürsten und Finanzen im Mittelalter« zu befassen, so prägnant auf den Punkt wie diese Bemerkung Levolds von Northof in seinem Fürstenspiegel von 1357/58. Dem Forschungsdesiderat einer Geschichte der fürstlichen Finanzen im Mittelalter begegnet dieser Tagungsband, indem darin nicht nur Finanzquellen und Schulden weltlicher Fürsten thematisiert werden, sondern auch der Blick auf geistliche Fürsten, auf Fürstinnen sowie auf fürstliche Witwer, auf Fürstenspiegel und überhaupt auf die Literatur jener Zeit und zudem auf den chinesischen Kaiser ausgedehnt wird. Fürstliche Finanzgeschichte unter Berücksichtigung der Genderforschung, im interdisziplinären Zugriff sowie im interkulturellen Vergleich – das hat es neben der Behandlung »klassischer« Felder der Fürstengeschichte so bisher noch nicht in einem Band versammelt gegeben!
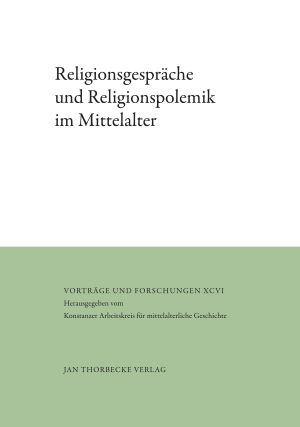
Vorträge und Forschungen: Religionsgespräche und Religionspolemik im Mittelalter
Bd. 96 (2023)
(vorerst nur Inhaltsverzeichnis)
Die christlich geprägten europäischen Reiche des Mittelalters waren in religiöser Beziehung keineswegs homogen. Kontakt, Kooperation und Konflikt mit anderen Konfessionen und Religionen mussten intellektuell und pragmatisch bewältigt werden. Unter den Medien, die die Auseinandersetzung
mit anderen Religionen zum Gegenstand haben, nehmen dialogisch gestaltete Texte eine zentrale Rolle ein, in denen Argumente zur Absicherung der eigenen Position und zur Überzeugung der Gegenseite
gesammelt wurden. Die Beiträge dieses interdisziplinären Sammelbandes thematisieren solche gedachten Religionsgespräche ebenso wie Hinweise auf real geführte Diskussionen über Fragen des Glaubens, spätmittelalterliche Zwangsdisputationen mit Vertretern jüdischer Gemeinden und Alltagsgespräche zwischen Christen und Juden. In den Blick genommen werden literarische und soziale Beziehungen zwischen christlichen und jüdischen Protagonisten, die Auseinandersetzung mit dem Islam in Spanien, die christlichen Mohammedviten und die konfessionelle Gemengelage im spätmittelalterlichen venezianischen Kreta.
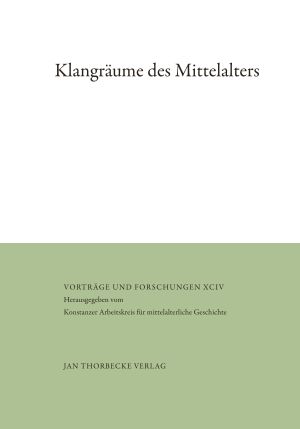
Vorträge und Forschungen: Klangräume des Mittelalters
Bd. 94 (2023)
Die Sinne haben in der jüngeren Mittelalterforschung Konjunktur. Immer häufiger werden sie zu Gegenstand kulturgeschichtlicher Studien, die noch kaum erforschte, hoch anregende Fragen aufwerfen: In welchem Maße und auf welche Weisen waren das Sehen und Hören, das Schmecken, Tasten und Riechen kulturell kodiert? Welche gesellschaftlichen Funktionen erfüllten Bilder, Geräusche, Gerüche? Im Fokus der dreizehn Aufsätze dieses Sammelbandes steht das weite Feld der mittelalterlichen Akustik. Die Autorinnen und Autoren erforschen zeitgenössische Haltungen zu Lärm und Schweigen; sie untersuchen den Einsatz von Geräuschen als Mittel der Repräsentation, der gesellschaftlichen Ordnung, der Anziehung und Abstoßung; und sie analysieren, wie im Mittelalter die Erzeugung und Wahrnehmung von Klängen besprochen, beschrieben, gemalt, gedeutet wurden. Die Beiträge liefern Einblicke in entfernte Räume – von Byzanz im Osten bis zur Iberischen Halbinsel im Westen, von Mitteleuropa bis in den Nahen Osten. Sie untersuchen Akustik aus der Perspektive unterschiedlicher historischer Teildisziplinen – der Geschichtswissenschaft und der Rechtsgeschichte, der Literaturwissenschaft, der Kunst- und der Musikgeschichte. Dadurch entsteht eine multidimensionale Bestandsaufnahme eines noch jungen Forschungsfeldes mit hohem Erkenntnispotential.
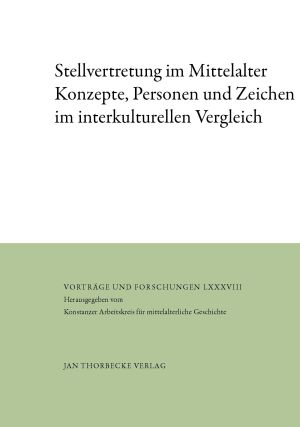
Vorträge und Forschungen: Stellvertretung im Mittelalter Konzepte, Personen und Zeichen im interkulturellen Vergleich
Bd. 88 (2023)
(vorerst nur Inhaltsverzeichnis)
Im Mittelalter war »Stellvertretung« zum einen als legitimierendes Prinzip sakraler Herrschaft (Stellvertretung Gottes/Christi auf Erden) von Bedeutung und zum anderen als notwendiges Herrschaftsinstrument im politischen und kirchlichen, aber auch wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Leben nahezu omnipräsent. Dennoch ist dieses Phänomen in der historischen Forschung – im Unterschied zur theologischen und
rechtshistorischen – bisher nur punktuell untersucht worden. Vor allem fehlt eine Auseinandersetzung mit den Konzepten sowie den begrifflich und inhaltlich zu unterscheidenden Formen von Stellvertretung. Mit dem vorliegenden Band sollen nun im Rahmen eines interkulturellen Vergleichs Konzepte, Personen und Zeichen von vornehmlich religiös konnotierter beziehungsweise im geistlichen Bereich angesiedelter Stellvertretung in den christlichen West- und Ostkirchen, dem Islam, dem Mongolenreich und Japan untersucht werden.

Vorträge und Forschungen: Herrschaft über fremde Völker und Reiche. Formen, Ziele und Probleme der Eroberungspolitik im Mittelalter
Bd. 93 (2022)
Der vorliegende Band rückt Eroberungen zum ersten Mal als ein Phänomen in den Blick, das auch im Mittelalter die politische Geschichte, die Bildung von Herrschaftsräumen und -techniken sowie die Entwicklung politisch wie kulturell bestimmter Identitäten entscheidend prägte. Er betrachtet, vielfach komparativ, die wichtigsten europäischen Eroberungen von der Spätantike bis ins 15. Jahrhundert und zeichnet nach, mit welchen Zielen und Methoden die Eroberer von Theoderich über Karl den Großen bis zu Eduard I., von den Normannen in Süditalien bis zum Deutschen Orden ihre Herrschaft über fremde Völker etablierten und mit deren Widerstand umgingen. Besondere Aufmerksamkeit findet zudem die Rechtfertigung von Eroberungen, ihre religiöse Aufladung in Byzanz und bei der Inbesitznahme nicht-christlicher Gebiete, aber auch die ambivalente Legitimation in Recht und Literatur. Am Ende entsteht so ein äußerst vielfältiges Bild der mittelalterlichen Eroberungspraxis und des mit ihr verbundenen Diskurses.

Vorträge und Forschungen: Zwischen Klausur und Welt. Autonomie und Interaktion spätmittelalterlicher geistlicher Frauengemeinschaften
Bd. 91 (2022)
Religiöse Frauengemeinschaften eröffnen faszinierende Einsichten in die kulturelle, intellektuelle und soziale Entwicklung im Mittelalter. In der Ordensforschung sind Frauen bisher dennoch vor allem als »pastorales Problem« in Erscheinung getreten. Die Erforschung der weiblichen Religiosen bietet deshalb als die vielleicht größte Forschungslücke der aktuellen Geschichtswissenschaft ein enormes Forschungspotenzial. Der vorliegende Band arbeitet mit interdisziplinärem Ansatz die zentrale Rolle religiöser Frauen, ihrer Visionen und Lebensentwürfe für die Entwicklung der vormodernen Gesellschaft heraus. Die vielschichtigen Beziehungen und Interdependenzen zwischen dem ›Sonderraum‹ Kloster und der Laiengesellschaft erhellen deshalb in besonderer Weise Neuansätze oder Wandel der mittelalterlichen Gesellschaft.

Vorträge und Forschungen: Ständische Grenzüberschreitungen
Bd. 92 (2021)
Ausgehend von der Einteilung der Gesellschaft in die drei Stände, wie sie Adalbero von Laon im 11. Jahrhundert entworfen hat, untersucht dieser Band die Frage nach dem Wechsel des Standes und dem kurzfristigen oder dauerhaften Überschreiten von dessen rechtlich fixierten, symbolisch definierten oder performativ gesetzten Grenzen im Spätmittelalter. Dabei geht es weniger um die Problematik des Aufstiegs von Bürgern in den Adel, als um den Wechsel in andere Richtungen wie etwa vom geistlichen Stand in den Adel und um das Aneignen von Symbolen eines anderen Standes. Ergänzend dazu werden Momente der Problematisierung von entsprechenden oder vermeintlichen Grenzüberschreitungen herausgearbeitet. Im Zentrum des Bandes steht daher die Frage nach der zeitgenössischen Selbstkonzeption, Selbst- sowie Fremdwahrnehmung derartiger Wechsel und Grenzüberschreitungen.
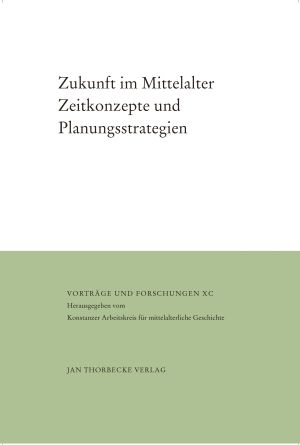
Vorträge und Forschungen: Zukunft im Mittelalter. Zeitkonzepte und Planungsstrategien
Bd. 90 (2021)
Die Zukunftsvorstellungen der mittelalterlichen Gesellschaften wurden bislang von der Forschung wenig beachtet. Sofern man überhaupt danach fragte, fand dies zumeist im Hinblick auf Vorstellungen von der Endzeit und dem apokalyptischen Geschehen statt. Ohne diese bedeutsamen transzendentalen Bezüge zu negieren, zeigen die Beiträge dieses Bandes die Existenz diesseitig orientierter Zukunftsvorstellungen im Mittelalter auf, die auf eine Zukunft mittlerer Reichweite abzielen. Die Untersuchung wirtschaftlicher Praktiken, prognostischer Verfahren, religiöser Vorstellungen und deren konkreter Umsetzung sowie expliziter Reflexionen über die Zukunft in Text und Bild macht deutlich: Die Gesellschaften des Mittelalters hatten reges Interesse an einer mittelfristigen Zukunft, zwischen dem Denken an das unmittelbare Morgen und der Vorsorge für das ewige Seelenheil.
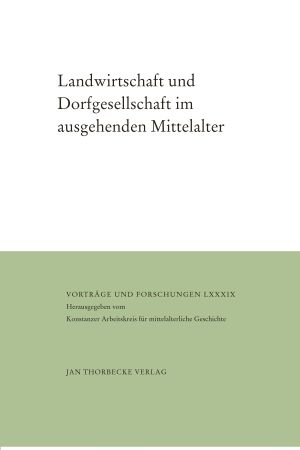
Vorträge und Forschungen: Landwirtschaft und Dorfgesellschaft im ausgehenden Mittelalter
Bd. 89 (2020)
Landwirtschaft und Dorf waren für die Lebenswelt der meisten Menschen Europas im Mittelalter und in der
Frühen Neuzeit bestimmend. Die Erforschung der ruralen Welt ist deshalb von grundlegender Bedeutung.
Der Schwerpunkt des vorliegenden Bandes liegt räumlich in Mitteleuropa und zeitlich im ausgehenden
Mittelalter. Gerade der Zeitraum um 1500 eröffnet aufgrund einer dichten Quellenlage nun auch für den
ländlichen Raum lohnende Forschungsperspektiven. Dies gilt nicht nur für klassische Bereiche der
Landwirtschaftsgeschichte wie die regional sehr unterschiedliche Agrarverfassung und die Formen der agrarischen Produktion: Ackerbau und Viehzucht sowie Sonderkulturen wie Weinbau. Darüber hinaus lassen sich für den angegebenen Zeitraum aber auch zentrale Probleme wie Umwelt und Klima, Marktorientierung, Organisation und Alltag der Dorfgesellschaft, das ländliche Leben in der Kunst und andere zentrale Fragen genauer betrachten. Die Agrargeschichte erweist sich dabei gerade in landesgeschichtlicher Vertiefung als ein fruchtbares Arbeitsfeld der Mittelalterforschung. Der vorliegende Band bietet zahlreiche neue Ergebnisse, liefert aber auch vielfältige Anregungen für die weitere Erforschung der Agrargeschichte und der ländlichen Lebenswelt des späten Mittelalters.

Vorträge und Forschungen: Kleine Welten. Ländliche Gesellschaften im Karolingerreich
Bd. 87 (2019)
Der Band zeichnet ein neues Bild ländlicher Gesellschaften im Karolingerreich. Er beobachtet das Miteinander von Menschen in Räumen, die kleiner waren als die Grafschaft und die Diözese. Wie waren diese »kleinen Welten« angebunden an die große Politik? Wie wurden Ziele des Herrschers und der Eliten hierher vermittelt? Und wie wurden Anliegen der Menschen vor Ort wieder an den Hof getragen? Das Buch beleuchtet, mit welchen Quellenarten sich lokale Gesellschaften beobachten lassen (Archäologie, Formulae, Urkunden, Hagiographie, Polyptycha).
Ein zweiter Teil widmet sich den Mittlern zwischen dem Hof und den regionalen Eliten sowie der lokalen Ebene (wie Priestern und weltlichen Amtsträgern). Der dritte Teil enthält Regionalstudien zu Bayern, dem Mittelrhein, Alemannien, der Toskana sowie – über das Karolingerreich hinausblickend – zur Bretagne und zu Nordspanien.
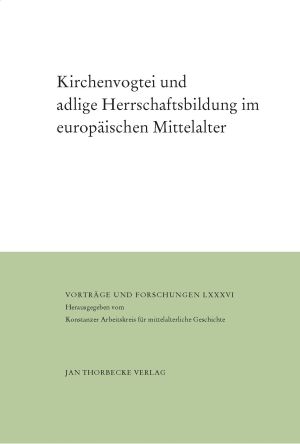
Vorträge und Forschungen: Kirchenvogtei und adlige Herrschaftsbildung im europäischen Mittelalter
Bd. 86 (2019)
Die Vogtei in ihren vielfältigen Ausprägungen gehört zu den grundlegenden Strukturelementen der mittelalterlichen Herrschaftsordnung. Im europaweiten Prozess der Entstehung von Landesherrschaften
spielte sie – lateinisch »advocatia« – in verschiedenen Zusammenhängen eine Rolle. Von besonderem Interesse ist dabei die Kirchenvogtei im Kontext adliger Herrschaftsbildung.
Indes gehört diese trotz einer für den deutschen Sprachraum kaum noch überschaubaren Fülle von Einzeluntersuchungen noch immer zu den Themen der Mittelalter- und Landesgeschichtsforschung, die einer überregionalen Zusammenschau entbehren. Mit dem vorliegenden Tagungsband soll eben diese vergleichende Betrachtung im europäischen Rahmen versucht werden. Das erscheint umso reizvoller, als das Thema Kirchenvogtei in jüngerer Zeit auch in Westeuropa zunehmend Interesse findet.
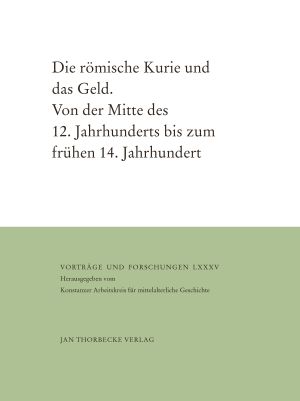
Vorträge und Forschungen: Die römische Kurie und das Geld. Von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum frühen 14. Jahrhundert
Bd. 85 (2018)
Die »Geldgier« der römischen Kurie war ein weit verbreitetes Klischee und Gegenstand der Satire seit dem späten 11. Jahrhundert. Dies stellt einen Indikator für die vielfältigen Bemühungen des Papsttums dar, den kontinuierlich wachsenden Apparat der Kurie zu finanzieren, da die üblichen Einnahmen aus dem Patrimonium Petri nicht mehr zur Bewältigung der von außen herangetragenen Aufgaben genügten. In diesem Sammelband behandeln vierzehn ausgewiesene Fachleute mit Beiträgen in deutscher, französischer und englischer Sprache (und einer Übersetzung aus dem Italienischen) die Einnahmen und Ausgaben der Zentrale der lateinischen Christianitas mit ihren weitgespannten Herrschaftsansprüchen. Die Palette der Themen ist breit: Numismatisches, die heterogenen Finanzierungsquellen des Papsttums, die Rolle der Kaufleute-Bankiers aus Rom, Siena, Florenz und anderen mittel- und oberitalienischen Kommunen, die Finanzen der Kardinäle, die hohen Kosten der Legationen, Finanzierung der Politik in der Auseinandersetzung um das Königreich Sizilien, das kanonische Zinsverbot, und anderes mehr. Dabei ergibt sich als Resultat der Untersuchungen, dass die frühkapitalistische Geldwirtschaft des Mittelalters durch das Papsttum und die römische Kurie einen erheblichen Entwicklungsschub verzeichnete.
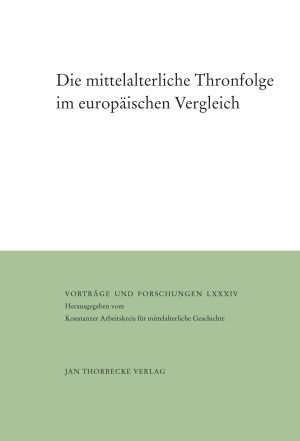
Vorträge und Forschungen: Die mittelalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich
Bd. 84 (2017)
In den letzten Jahren hat sich auch der Blick auf das Mittelalter insgesamt gewandelt. Das europäische Mittelalter wird nicht mehr einfach nur als Vorgeschichte der Moderne begriffen, sondern als ganz eigenständige Epoche. In diesem Sinne kann man von einer anthropologischen Wende der Mediävistik sprechen, die sich auch nachhaltig auf die Themen der Verfassungsgeschichte ausgewirkt hat. Die Forschung konzentriert sich auf die personalen Beziehungen zwischen den verschiedenen Herrschaftsträgern, doch bleibt die Frage umstritten, bis zu welchem Grad man in dieser Zeit bereits zwischen der öffentlichen Funktion des Königs als überzeitlichem Repräsentanten des Gemeinwesens und seiner Eigenschaft als sterblicher Mensch zu unterscheiden wusste. Ein für die Verfassung mittelalterlicher Reiche zentraler Aspekt ist die Thronfolge, deren Dimensionen im vorliegenden Band vergleichend untersucht werden: die Rolle der Königin, die Funktion der Herrschersakralität oder das Phänomen strittiger Thronfolgen.

Vorträge und Forschungen: Maritimes Mittelalter. Meere als Kommunikationsräume
Bd. 83 (2016)
Die Geschichte der Meere wird im Hinblick auf das Mittelalter bisher meist als Geschichte von Spezialthemen (z.B.: Hanse; Wikinger) oder als Domäne besonderer Fachdisziplinen (Wirtschafts- bzw. Technikgeschichte) behandelt und wahrgenommen. Aus breiterer, komparatistischer Perspektive ist es allerdings angezeigt, das Meer nicht als Sondergebiet historischer Forschung, sondern als Teil der Erfahrungen und Vorstellungen der Menschen im mittelalterlichen Jahrtausend ernst zu nehmen. Die maritime Welt war keine separierte geographische
Zone, sondern untrennbarer Bestandteil der mittelalterlichen Geschichte überhaupt. Der Band
bietet mit Studien zu europäischen Binnengewässern (Nord- und Ostsee, Schwarzem Meer) und zu interkontinentalen Meeren (Mittelmeer, Atlantik und Indik) Wegweisendes aus mediävistischer, skandinavistischer, islamwissenschaftlicher und indologischer Perspektive. Die in den Beiträgen zum Ausdruck kommende Umkehrung der gebräuchlichen »terrestrischen« Perspektive trägt dazu bei, der Mittelalterforschung ungewohnte Einblicke zu öffnen.

Vorträge und Forschungen: Recht und Konsens im frühen Mittelalter
Bd. 82 (2017)
Gab es konsensual, d.h. unter verantwortlicher Mitwirkung der Großen getragene politische Entscheidungen im Frühmittelalter? Durchaus, und zwar vor allem im Bereich des Rechts. Weil die Rechtseinheit des römischen Imperiums im 5. Jh. mit der politischen Einheit verloren gegangen war, mussten die Rechtsordnungen der neuen gentilen Königreiche auf den Konsens der ethnisch und religiös heterogenen Bevölkerungsgruppen gegründet werden. Normsetzende Konzilsbeschlüsse fußten in theologischer Deutung auf dem inspirierten Wahrheitskonsens der Teilnehmer. Das Bild der sog. Völkerwanderungsepoche als kriegerischer Krisenzeit wird in diesem Band daher modifiziert durch die Beobachtung und Analyse vielfältiger Anwendungen des Konsenses als Prinzip der Herstellung von Recht und Legitimität. Als Überführung von Fremdbestimmung in Selbstzwang konnte er integrierend auf die neuen politischen Einheiten wirken, weil er ethnische und religiöse Differenzen zu überwinden half.

Vorträge und Forschungen: Mächtige Frauen?
Bd. 81 (2015)
Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11. – 14. Jahrhundert)
Die Frage nach Macht und Herrschaft von hochadligen Frauen im Mittelalter ist in den letzten Jahrzehnten verstärkt in den Fokus der internationalen Forschung gerückt. Der Blick richtete sich dabei vor allem auf diejenigen Königinnen, denen es günstige familiäre und strukturelle Umstände ermöglichten, als regierende Königinnen hervorzutreten oder die Regentschaft für ihre abwesenden Gatten oder unmündigen Söhne auszuüben. Der vorliegende Band erweitert diesen von einem offenen Machtbegriff ausgehenden Diskurs durch die vergleichende Gegenüberstellung von Königinnen und Fürstinnen in verschiedenen Reichen und Regionen Europas im Hoch- und Spätmittelalter. Nach grundlegenden Überlegungen zur Frage, was Macht im Mittelalter bedeutet, folgen Beiträge zu Königinnen und Fürstinnen in den iberischen Reichen, in den Kreuzfahrerherrschaften, in England und Frankreich, in Oberitalien, den habsburgischen Gebieten im Südwesten des römisch-deutschen Reichs und in Tirol. Eigens betrachtet werden die Krönungsordines für Kaiserinnen und Königinnen, die Papstbriefe an Königinnen und Fürstinnen sowie die Bedeutung der geistlichen Fürstinnen vom 11. bis zum 14. Jahrhundert.

Vorträge und Forschungen: Gewalt und Widerstand in der politischen Kultur des späten Mittelalters
Bd. 80 (2015)
Physische Gewalt war Bestandteil der Ausübung von Macht und Gerichtsgewalt im Mittelalter. Als Androhung präsent, konnte auf sie demonstrativ verzichtet oder ihre Anwendung mit expressiver Deutlichkeit vorgenommen werden. Indem der Umgang mit Gewalt und die Legitimität von Herrschaftsausübung wechselseitig aufeinander bezogen blieben, spiegelte sich die Gewaltpraxis in Formen des Widerstands. Die Spezifik der Gewaltausübung gehört zu einer besonderen politischen Kultur, die sich von der modernen deutlich unterscheidet. Nicht um eine herrschaftstheoretische Definition von Gewalt geht es den dreizehn hier versammelten Beiträgen, sondern um die exemplarische Beschreibung von aussagekräftigen Einzelfällen und den internationalen wie interkulturellen Vergleich. Letzterem dienen Beispiele aus der Geschichte Europas und des arabisch-islamischen Raumes.

Vorträge und Forschungen: Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis
Bd. 79 (2014)

Vorträge und Forschungen: Akkulturation im Mittelalter
Bd. 78 (2014)

Vorträge und Forschungen: Die Pfarrei im späten Mittelalter
Bd. 77 (2013)
Im späten Mittelalter war die Pfarrei für die meisten Menschen eine alltägliche Erfahrung. Die zahlreichen Pfarrkirchen in Stadt und Land fungierten nicht nur als Stätten von Gottesdienst und Seelsorge, sondern waren auch Schnittstellen zu vielen weltlichen Lebensbereichen. Die Beiträge dieses Bandes betrachten die Pfarrei deshalb aus ganz unterschiedlichen weltlichen wie kirchlichen Perspektiven und bieten viele neue Forschungsergebnisse zum Verhältnis von Kirche und Welt in den Jahrhunderten vor der Reformation.

Vorträge und Forschungen: Ausbildung und Verbreitung des Lehnwesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert
Bd. 76 (2013)
Ausbildung und Verbreitung des Lehnwesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert
Angesichts der scheinbar gesicherten Vorstellung eines bereits im 9. Jahrhundert von den Karolingern auf breiter Basis als Herrschaftsmittel eingesetzten Lehnswesens, das im 10. bis 13. Jahrhundert seine klassische Blütezeit erlebt habe, wirkte das 1994 erschienene Buch von Susan Reynolds »Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted« wie ein Schock. Ihrer Meinung nach hätten bisherige Historiker eine erst im 16. Jahrhundert durch juristische Systematisierung entstandene Vorstellung von einer engen Verknüpfung von Vasallität und Lehen auf die Verhältnisse des Früh- und Hochmittelalters übertragen. Das Buch von Susan Reynolds löste eine internationale Debatte um eine Neubewertung des Lehnswesens aus. Trotz zahlreicher Einwände im Detail blieb die Hauptthese bestehen und wurde auf mehreren Konferenzen diskutiert. Die Tagung »Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert« im April 2011 auf der Insel Reichenau setzte die Diskussion über eine Neubewertung des Lehnswesens fort und nahm dabei besonders das 12. und das 13. Jahrhundert in den Blick. Führende Mediävisten und Rechtshistoriker hinterfragen in dem vorliegenden Band gesicherte Handbuchmeinungen vom Lehnswesen im Umfeld des Papsttums, in Oberitalien und im Reich und machen neue Deutungen plausibel.
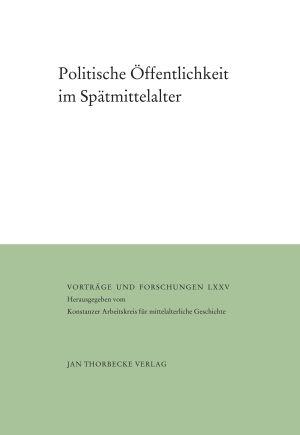
Vorträge und Forschungen: Politische Öffentlichkeit im Spätmittelalter
Bd. 75 (2011)
Politische Öffentlichkeit im Spätmittelalter
Öffentlichkeit ist nicht erst in der Moderne, sondern war bereits im europäischen Spätmittelalter ein Instrument der Informationsverbreitung in der Gesellschaft. Auch zeremonielle Inszenierungen an den Höfen waren Teil der politischen Kommunikation, mit der man sich über gegenseitige Ansprüche und Erwartungen austauschte und die eigenen Interessen zur Geltung brachte. Öffentlichkeit war konstitutiv für die Repräsentation politischen Handelns. Erst indem politische Akte, Verlautbarungen, Begegnungen und Entscheidungen öffentlich gemacht wurden, konnte es ihnen gelingen, den für ihre Umsetzung notwendigen Konsens, Zustimmung und Gefolgschaft zu finden. Politische Öffentlichkeit wurde damit zu einer entscheidenden Grundlage für die Stabilität und Geltung der gesellschaftlichen und herrschaftlichen Ordnung. Das Publikum bei Inszenierungen, die Adressaten der Akte politischen Handelns und Empfänger publizistischer und propagandistischer Veröffentlichungen waren häufig nicht identisch, sondern jeweils besondere „Teil-Öffentlichkeiten“ innerhalb der zeitgenössischen Gesellschaft. Die Beiträge des Bandes untersuchen die politische Öffentlichkeit des Spätmittelalters in verschiedenen disziplinären, medialen und funktionalen Kontexten und verdichten die vorgetragenen Forschungsergebnisse zu einer neuartigen Geschichte der politischen Kultur.

Vorträge und Forschungen: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit
Bd. 74 (2011)
Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit
Die gesammelten Aufsätze zum Thema Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit versuchen zu klären, wie es in Böhmen unter der rund vier Jahrhunderte umfassenden Herrschaft der Přemysliden-Dynastie (ca. 900 bis 1305) zu einer Reichsbildung kam, die einerseits die Grundlagen zu einer selbständigen Staatsbildung schuf und die sich andererseits in einem engen Interdependenzverhältnis zu den benachbarten Nationen vollzog. Die Felder, auf denen dies untersucht wird, sind die politischrechtlich-soziale Verfaßtheit des Landes, die Rolle der Kirche und der Kultbeziehungen, die Orientierung des Adels, die von Hegemoniebestrebungen der Přemyslidenfürsten gegenüber den polnischen und ungarischen Nachbarn geprägten »Außenbeziehungen« sowie das Verhältnis Böhmens und seiner Herrscher zu Kaiser und Reich. Darüber hinaus galt es, den wissenschaftspolitischen Versuch zu wagen, eine Diskursfähigkeit, wenn möglich eine Verständigung herzustellen zwischen Gelehrten, deren Weltbild und historiographische Tradition sich in den letzten beiden Jahrhunderten zunächst unter nationalstaatlicher, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eher unter westlich-‚bürgerlicher’ resp. östlich-marxistischer Prämisse in sehr unterschiedlicher Richtung entwickelt hatten und die unter dem Signum eines vereinten Europa zu einer Neuorientierung zu kommen suchen.