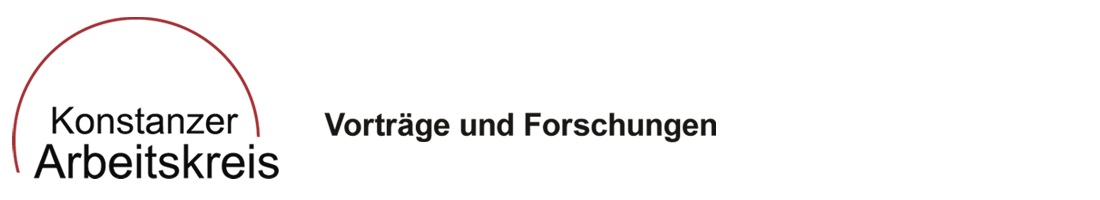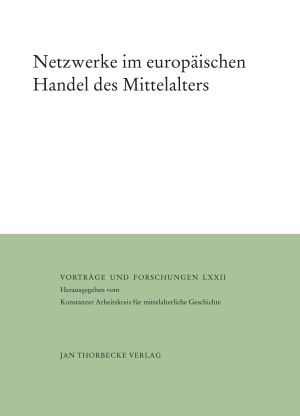Archiv
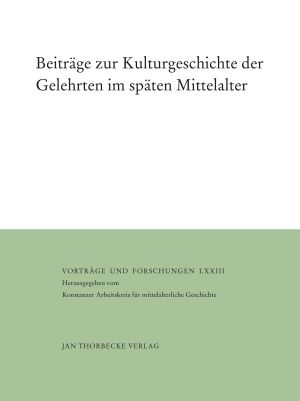
Vorträge und Forschungen: Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter
Bd. 73 (2010)
Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im späten Mittelalter
Gelehrte zeichnen sich nicht nur durch das Wissen aus, über das sie verfügen, sondern ebenso durch besondere Arten zu denken, zu argumentieren und zu leben. Sie prägen einen eigenen Habitus aus, der ihnen in ihrer Umwelt gleichermaßen Respekt verschafft und Anlass zu Kritik bietet. Auch wenn es bereits in den Jahrhunderten zuvor durchaus gelehrte Einzelpersonen gab, erlangt der kulturelle Typus des Gelehrten mit dem Aufschwung der wissenschaftlichen Schulen während des 12. Jahrhunderts eine Bedeutung, die er vormals zuletzt in der Antike gehabt hatte. Der Konstanzer Arbeitskreis versammelte während einer seiner Tagungen die einschlägigen Experten der spätmittelalterlichen Gelehrtenkultur und legt nun einen Band vor, der die lebensweltliche Bedeutung des "höheren" Wissens dokumentiert. Die Beiträge behandeln das literarische und ikonographische Bild von Gelehrten, ihr Familienleben, ihren Bücherbesitz und ihre Patronage-Strategien. Die Lebensentwürfe christlicher werden mit denen jüdischer und muslimischer Gelehrter verglichen.
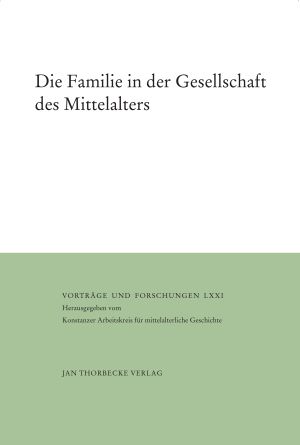
Vorträge und Forschungen: Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters
Bd. 71 (2009)
Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters
In den vergangenen Jahren wurde intensiv über die Rolle der Familie in der heutigen Gesellschaft gestritten, so daß es schon aus diesem Grund gerechtfertigt erscheint, nach den Erscheinungsformen der Familie im Mittelalter zu fragen. Die Thematik ist auch deshalb als Desiderat anzusehen, weil sie in der deutschen Mediävistik bislang nicht allzu intensiv behandelt wurde. Bereits im Titel des Bandes wird das Konzept erkennbar, den Fokus auf die (Kern-)Familie zu richten, obwohl die mittelalterlichen Quellen für dieses Sozialgebilde keinen spezifischen Begriff kennen. Das aus dem Französischen stammende Lehnwort »Familie« wird bekanntlich erst seit dem 18. Jahrhundert im heutigen Sinn gebraucht. Gemäß der für die Konzeption des Tagungsbandes maßgebenden These gab es die Kernfamilie mit ihrem besonderen Bezugssystem zwischen Eltern und Kindern als anthropologische Konstante bereits im Mittelalter, doch war sie so eingebettet in größere Zusammenhänge, wie Haushalt mit Gesinde, Hofgesellschaft oder Verwandtschaftsverbände, daß sich kein eigener Begriff entwickeln konnte. Selbstverständlich wird damit nicht für eine unbefangene Übertragung der heutigen Vorstellungen von Familie auf das Mittelalter plädiert, doch wird das emotionale Beziehungssystem zwischen Familienangehörigen als eine Konstante betrachtet, die sich deutlich von den Bindungen an Mägde, Knechte, Hofleute oder entfernte Verwandte unterschied. Erst mit der zunehmenden Herauslösung der Kernfamilie aus diesen größeren Sozialverbänden in der Neuzeit ergab sich die Notwendigkeit für eine eigene Begrifflichkeit.
Der Band vereinigt interdisziplinäre Beiträge zur Darstellung der Familie in Kunst und Literatur, zur Analyse der Familien im Adel, im Bürgertum und in der bäuerlichen Gesellschaft. Weiterhin wird die Übertragung familiärer Vorstellungen auf andere personale Beziehungsnetze untersucht. Zum Vergleich der westeuropäischen Familienstrukturen mit solchen außerhalb des Okzidents dient ein Blick auf die Rjurikiden. Ein Beitrag zum Stand der historischen Familienforschung fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen von Jack Goodys wegweisendem Buch »Entwicklung von Ehe und Familie in Europa« und die bis in das Frühmittelalter ausgreifende Zusammenfassung runden den Band ab.
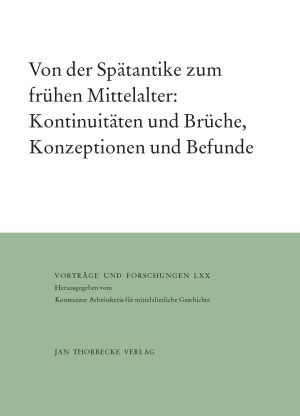
Vorträge und Forschungen: Von der Spätantike zum frühen Mittelalter: Kontinuitäten und Brüche, Konzeptionen und Befunde
Bd. 70 (2009)
Von der Spätantike zum frühen Mittelalter: Kontinuitäten und Brüche, Konzeptionen und Befunde
Von der Spätantike zum frühen Mittelalter – das Thema des Bandes betrifft ein klassisches »Problem historischer Periodenbildung«, zumal sich damit der Übergang von der antik-mediterranen zur westeuropäisch-nordalpinen Zivilisation verbindet. Diskutiert wurde es schon oft und mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen, nicht zuletzt aufgrund bestimmter ideologischer oder nationalistischer Prädispositionen oder ganz spezifischer Fokussierung. Es geht bei diesem Themenkreis also nicht zuletzt auch um das Problem der Theoriebildung und -kritik. Ziel der Frühjahrstagung 2007 war es, eine Bilanz der gerade in jüngster Zeit wiederbelebten Forschung über diesen vielschichtigen Transformationsprozess zu bieten – aus historischer, rechtshistorischer, sprachwissenschaftlicher und archäologischer Perspektive.

Vorträge und Forschungen: Heinrich IV.
Bd. 69 (2009)
Heinrich IV.
Die Urteile der Zeitgenossen über Kaiser Heinrich IV. unterscheiden sich signifikant von denen der modernen Forschung. In diesem Band wird der Versuch unternommen, den Gründen für diese Diskrepanz auf die Spur zu kommen. Ergebnis ist eine systematische Bewertung der Argumente, die zeitgenössische Anhänger wie Gegner Heinrichs für oder gegen ihn vorbrachten. Unabhängig von der Richtigkeit der Argumente ergibt sich so ein Zugang zum Verständnis des politischen Klimas der Zeit. Fundamentale Konflikte und Krisen der Herrschaft Heinrichs IV. lassen sich so in neuer Weise deuten.
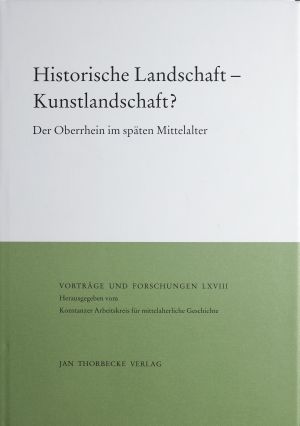
Vorträge und Forschungen: Historische Landschaft - Kunstlandschaft? Der Oberrhein im späten Mittelalter
Bd. 68 (2008)
Historische Landschaft - Kunstlandschaft?
Der Oberrhein im späten Mittelalter
"Historische Landschaft" und "Kunstlandschaft" sind wissenschaftsgeschichtlich betrachtet höchst problematische Begriffe, da sie in einer Zeit entstanden, in der die Forschung von Konstanten ausging, welche die Bewohner bestimmter Regionen innerhalb großer Zeiträume geprägt haben sollen. Angeblich waren diese Konstanten durch die natürliche Beschaffenheit der Umwelt ebenso vorbestimmt wie durch den genetisch bedingten "Volkscharakter" der Bevölkerung innerhalb festumrissener Landstriche, was zu spezifischen Verhaltens- und Ausdrucksweisen geführt haben soll. Im Gegensatz dazu wird in den hier vorgelegten Beiträgen am Beispiel des geschichtlich wie kulturell facettenreichen Oberrheinraums dargelegt, daß die Vorgaben, anhand derer sich eine "Historische Landschaft" beziehungsweise eine "Kunstlandschaft" ausweisen läßt, nichts anderes als zeitbedingte Auswirkungen gut funktionierender Netzwerke darstellen, die sich nicht nur in sämtlichen Bereichen der Geschichte, sondern auch in der Kunstgeschichte nachweisen lassen. Hinzu kommt die Ausstrahlung regionaler Zentren, die sich in den davon berührten Gegenden in vielfältigen Lebensbereichen manifestiert. Beides führt zur Herausbildung von Merkmalen, die man als regionaltypisch innerhalb bestimmter Epochen und räumlich begrenzter Strukturen, keineswegs aber als konstante "Wesenheiten" für die Dauer langer Zeitabläufe betrachten darf.

Vorträge und Forschungen: Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414 – 1418) und Basel (1431 – 1449)
Bd. 67 (2007)
Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414 - 1418) und Basel (1431 - 1449). Institution und Personen
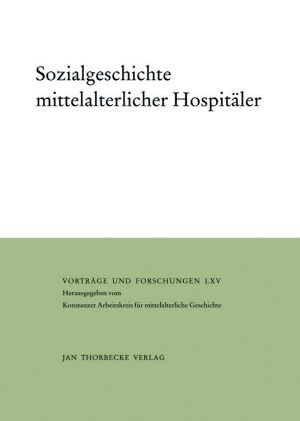
Vorträge und Forschungen: Sozialgeschichte mittelalterlicher Hospitäler
Bd. 65 (2007)
Sozialgeschichte mittelalterlicher Hospitäler
Angesichts der Tatsache, daß die bestehenden Sozialsysteme derzeit einer kritischen Revision unterzogen werden, rückt die Frage in den Vordergrund, ob es im Mittelalter bereits etwas Vergleichbares gab, das man als soziales Engagement bezeichnen kann. Wie läßt sich im Mittelalter Verantwortlichkeit für Armut, Bedürftigkeit und Krankheit feststellen? Wie wurden entsprechende Bedürfnisse befriedigt? Wie verhielten sich Leistungen und Ansprüche zueinander? Wer fiel durch dieses "Netz" und wer wurde darin aufgefangen? Solchen und ähnlichen ganz aktuellen Fragen wird in diesem Band in interdisziplinärer Weise nachgegangen. Gerade in der Einbeziehung gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse liegt sein besonderer Zuschnitt.
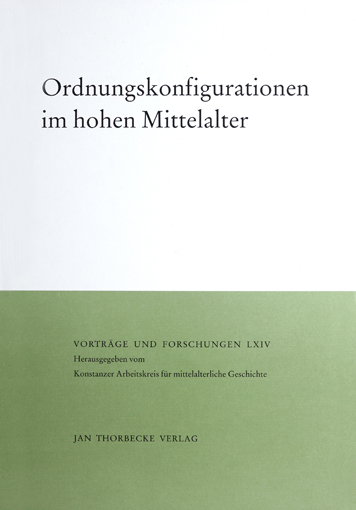
Vorträge und Forschungen: Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter
Bd. 64 (2006)
Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter
Ordnungskonfigurationen – dieser Band dokumentiert ein wissenschaftliches Experiment. Es will den traditionellen Verfassungsbegriff der Mediaevistik überwinden und seiner Statik entkommen. Analysiert werden beständige Wandlungen gelebter und gedachter Ordnungen in ihrer Verschränkung, im Rückblick fixiert und dynamisiert. Historiker, Philosophen, Kunsthistoriker und Rechtshistoriker erproben einen neuen methodischen Zugriff auf zentrale Erscheinungen der hochmittelalterlichen Welt. Ordnung als Prinzip, als Veränderung und als Erkenntnisinteresse verbindet sich mit dem Nachdenken über die Begriffskarriere des deutschen Worts Ordnung.

Vorträge und Forschungen: Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa
Bd. 63 (2005)
Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa
Der vorliegende Band bietet zwanzig Beiträge, in denen das aktuelle Thema der »Politischen Integration« auf seine mittelalterliche Vorgeschichte hin untersucht wird. Das Zusammenbinden von Herrschaften, Ländern, Königreichen zu einem Ganzen, das mehr als nur die Summe der Einzelteile bildete, erfolgte selten nach einem strategisch konzipierten Plan, aber es läßt sich in den meisten der hier aufgeführten Beispiele gut nachzeichnen. Damit leistet dieser Sammelband einen Beitrag zu einer Verfassungsgeschichte Europas, deren Wurzeln sich weit ins Mittelalter zurückverfolgen lassen.
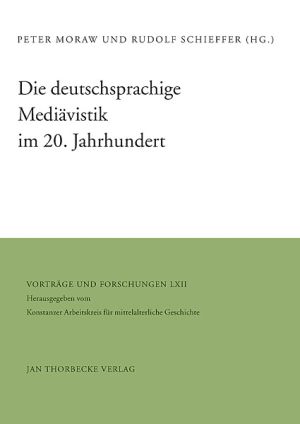
Vorträge und Forschungen: Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert
Bd. 62 (2005)
Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert
Was hat die deutsche Mittelalterforschung im Laufe des 20. Jahrhunderts beschäftigt, und worin unterschied sie sich von der Mediävistik in anderen Ländern? Wie hat sie auf gesellschaftlichen Wandel und politische Umbrüche reagiert, sich den Herausforderungen oder Zumutungen des wechselnden Zeitgeistes geöffnet, gar selbst Anstöße für das allgemeine Bewußtsein gegeben? Wie haben sich ihre materiellen Rahmenbedingungen, ihre Arbeitsformen und ihre öffentliche Beachtung verändert? Zehn Autoren geben Antworten aus ganz verschiedenen Blickwinkeln.

Vorträge und Forschungen: Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland
Bd. 61 (2005)
Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland
Mit der Frage nach der Bedeutung und den Inhalten, aber auch der Tragfähigkeit des Begriffes »Landesbewußtsein« für die unterschiedlichen Formen regionaler Identität im spätmittelalterlichen Deutschland greift der Band die lebhafte Forschungsdiskussion zur regionalen Identitätsbildung im Spätmittelalter auf. Er verbindet in Kombination repräsentativer Fallstudien und vergleichender systematischer Analyse die Einzeluntersuchung ausgewählter Beispiele (Schwaben, Westfalen, Österreich, Niederlande, die Rheinlande, Schlesien sowie Flandern als aufschlußreichem Vergleichsbeispiel außerhalb des Reiches) mit übergreifenden Beiträgen zum spätmittelalterlichen Landesbegriff, zur Landesgeschichtsschreibung des deutschen und europäischen Humanismus und zum europäischen Vergleichshorizont der deutschen Länder.
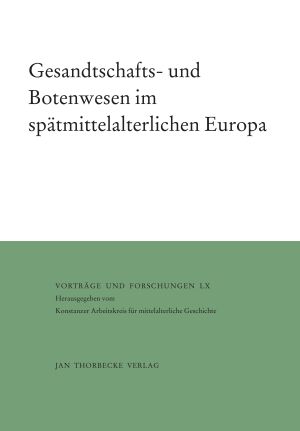
Vorträge und Forschungen: Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa
Bd. 60 (2003)
Gesandschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa
Der diplomatische Verkehr, der die politischen Beziehungen zwischen den Mächten des mittelalterlichen Europa mit geprägt hat, ist von der historischen Forschung nicht in gleicher Weise beachtet worden wie andere Themen. Insbesondere fehlt es an vergleichenden Untersuchungen. Die Beiträge dieses Bandes versuchen dem Thema in doppelter Weise gerecht zu werden, indem sie zum einen nach den allgemeinen Rahmenbedingungen des Gesandten- und Botenwesens fragen, z.B. nach den beteiligten Personen, den äußeren Voraussetzungen und Örtlichkeiten der Verhandlungen, den Modalitäten der Kommunikation, insbesondere der Verhandlungssprache, den rechtlichen und zeremoniellen Formen. Zum anderen wird die spätmittelalterliche Praxis an unterschiedlichen Fallbeispielen vorgeführt, z.B. aus dem politischen Umfeld der europäischen Monarchien, der Eidgenossenschaft und der Hanse, der römischen Kurie, der Republik Venedig und von Byzanz.
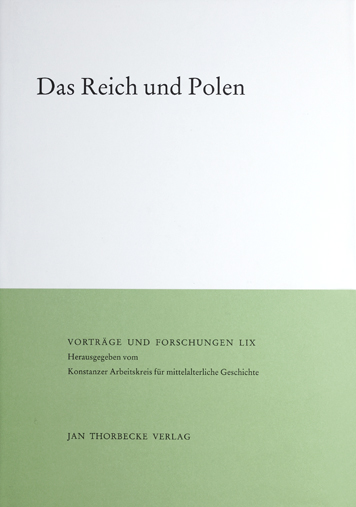
Vorträge und Forschungen: Das Reich und Polen
Bd. 59 (2003)
Das Reich und Polen. Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation im hohen und späten Mittelalter
Was verbindet Deutsche und Polen seit dem Mittelalter? Wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede in der historischen Entwicklung Deutschlands und Polens vor der Neuzeit? Und wie ordnen sich die Wege beider Großreiche in den Zusammenhang der Entstehung Europas im Spätmittelalter ein? Ein Konsortium deutscher und polnischer Forscher geht diesen und weiteren Fragen nach. Ziel ist es, immer noch bestehende Wissensdefizite um die gewachsenen "Ostbindungen" des deutschen Reichs seit dem Hochmittelalter zu beseitigen. Behandelt werden Themen, die aussagekräftig sind für deutsche, polnische und europäische Belange: Adelskultur, Kirchenstruktur, Heiligenverehrung, ethnischer Pluralismus, dazu politische, religiöse, künstlerische und wissenschaftliche Kontakte über den nationalen Rahmen hinweg. Mit der Blickrichtung auf Interaktionen und kulturelle Austauschprozesse werden sachlich und methodisch neue Anstöße vermittelt. Es zeigt sich, daß deutsche Geschichte ohne Berücksichtigung der Kontakte mit den östlichen Nachbarn nicht zu verstehen ist. Der Reichtum der deutschpolnischen Beziehungsgeschichte des Mittelalters vermag so ein Fundament auch für die politische Reflexion der Gegenwart zu bilden.
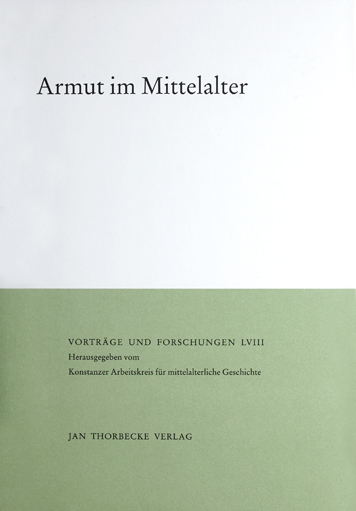
Vorträge und Forschungen: Armut im Mittelalter
Bd. 58 (2004)
Armut im Mittelalter
In Zusammenarbeit von Historikern mit Vertretern der Kunstgeschichte und der Literaturwissenschaft erörtern die Beiträge des vorliegenden Bandes die Bedingungen der Entstehung von Armut im Mittelalter, die »Kultur« der Armen, ihre Mentalitäten und Lebensformen und die Deutungen der Armut durch jene, die nicht arm waren.
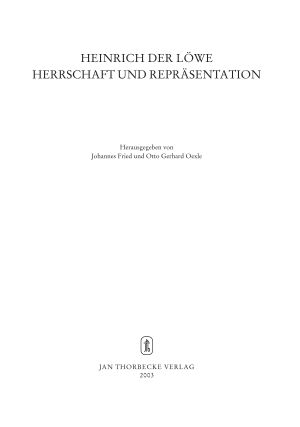
Vorträge und Forschungen: Heinrich der Löwe. Herrschaft und Repräsentation
Bd. 57 (2003)
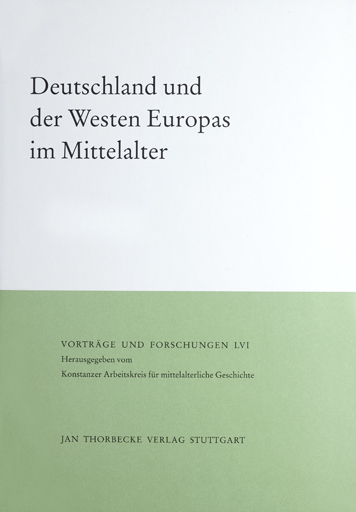
Vorträge und Forschungen: Deutschland und der Westen Europas im Mittelalter
Bd. 56 (2002)
Deutschland und der Westen Europas im Mittelalter
Die Frage nach den Beziehungen der Mitte Europas zu dessen westlichen Gebieten muß im Zeitalter der sich vergrößernden Europäischen Union in einem umfassenden Sinne neu gestellt werden. Das gelingt nicht durch die Addition von Spezialuntersuchungen zu Einzelproblemen, sondern nur durch eine breit angelegte Synthese verschiedener Ansätze im Zusammenwirken mehrerer Disziplinen. Alle Beiträge des Bandes gehen deshalb der Frage nach, unter welchen Umständen und auf welchen Wegen sich jener Akkulturationsprozeß vollzogen hat, der das mittelalterliche Europa hervorgebracht hat.
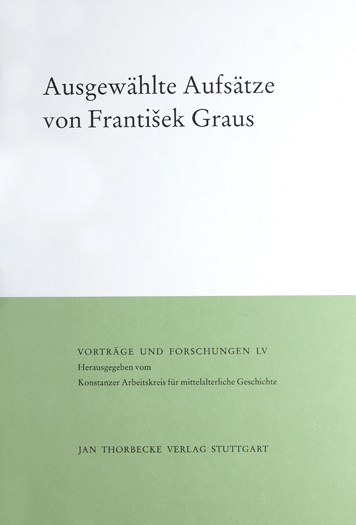
Vorträge und Forschungen: Ausgewählte Aufsätze von František Graus
Bd. 55 (2002)
Ausgewählte Aufsätze von František Graus
František Graus (1921-1989) lehrte in Prag, Gießen und Basel Mittelalterliche Geschichte. Seine Forschungen umfaßten ein ungewöhnlich breites Spektrum von Themen der Sozial- und Kulturgeschichte, der Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte vom frühen bis zum späten Mittelalter. Besonderes Gewicht kommt in seinem Werk aus ebenso biographischen Gründen wie übergeordneten Interessen der Geschichte der Juden zu. In der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft hat er so bahnbrechend gewirkt, daß die Rezeption seiner Arbeiten immer wieder neu gerade in jenen Gebieten zu beobachten ist, die in diesem Band mit einigen Beispielen vertreten sind und die ihm selbst am Herzen lagen: Hagiographie Tradition Geschichtsschreibung; Verfassungsgeschichte; Juden und Randgruppen; Mentalität und Krise.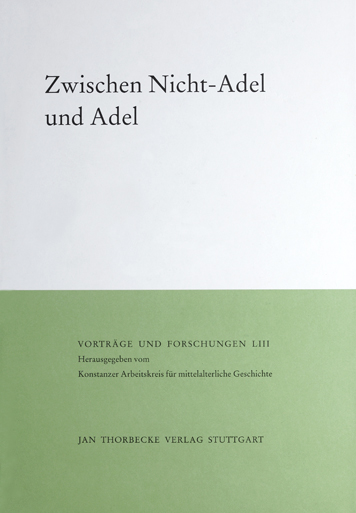
Vorträge und Forschungen: Zwischen Nicht-Adel und Adel
Bd. 53 (2001)
Zwischen Nicht-Adel und Adel
Der vorliegende Band befaßt sich mit sozialer Dynamik im späten Mittelalter, des näheren mit Adel in statu nascendi. Gefragt wird u. a. nach dem Werden von Oberund Führungsschichten auf dem Lande und in der Stadt, nach Wegen und Instrumentarien ihres Erfolgs, nach den Merkmalen sozialer Distanz nach unten und nach oben sowie nach der Kohärenz in der Gruppe und nach sonstigen Gesichtspunkten, die für den Aufstieg in den Adel respektive für den Niedergang aus der Oberschicht von Bedeutung sind. Die in diesem Band erstmals überregional thematisierte Grauzone zwischen Adel und Nicht-Adel verdient auch künftig die Aufmerksamkeit der Forschung.
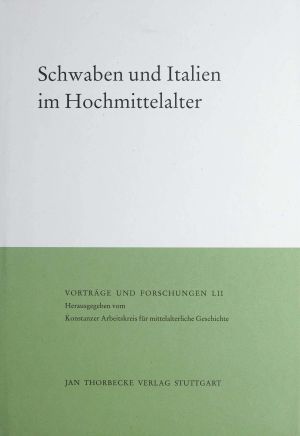
Vorträge und Forschungen: Schwaben und Italien im Hochmittelalter
Bd. 52 (2001)
Schwaben und Italien im Hochmittelalter
Schwaben und Italien sind zwei aneinander angrenzende Gebiete, die durch das ganze Mittelalter hindurch im permanenten kulturellen, geistigen und wirtschaftlichen Austausch standen. Beide gehörten zum fränkischkarolingischen Großreich, in dessen Auflösungsprozeß sich jedoch im Verlauf des 10. Jahrhunderts im Regnum Italiae wie im Herzogtum Schwaben politische Strukturen und schließlich auch eigenständige Traditionen herausbildeten, die in die "Italienpolitik" der deutschen Könige einmündeten. Die gemeinsamen politischen Herrschaftsformen waren verbindende Elemente über die Sprachgrenzen hinweg, und erst allmählich haben die verschiedenartigen sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten einen Bewußtseinswandel hier wie dort herbeigeführt. Vor allem im Verlaufe des 11. und 12. Jahrhunderts vollzog sich der Wandel in der Sicht des "Anderen".
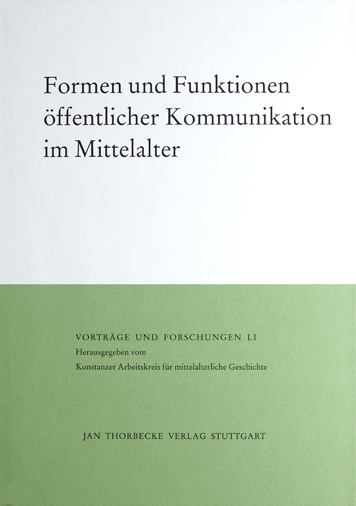
Vorträge und Forschungen: Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter
Bd. 51 (2001)
Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter
Das Mittelalter hat eine Kultur der Inszenierung, der »Performance« entwickelt, die modernen Menschen fremd ist und die sie eher negativ bewerten. Es gilt aber zunächst zu verstehen, welche Leistung diese Kommunikation mittels Gesten, Gebärden und Ritualen erbrachte, die im Mittelalter weit vor dem verbalen Diskurs die öffentliche Kommunikation bestimmte. Es gab ein Arsenal von Zeichen für Uber- wie für Unterordnung oder auch für Gleichrangigkeit. Dergestalt rituelle Kommunikation bewirkte eine stete Selbstvergewisserung der Beteiligten über ihre Beziehungen; sie begründete aber auch die Verpflichtung, sich dem Gezeigten gemäß zu verhalten, und trug so nicht unwesentlich zur Stabilisierung der Ordnungen bei.
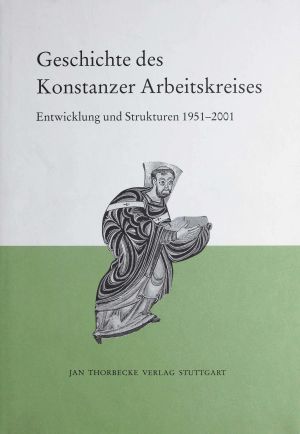
Geschichte des Konstanzer Arbeitskreises
2001
Entwicklung und Strukturen 1951 – 2001
Der fünfzigste Jahrestag der Entstehung des Konstanzer Arbeitskreises bot den Anlaß, die längst erwünschte Geschichte dieser Institution vorzulegen. Traute Endemann geht der Vorgeschichte und den Anfängen nach und zeigt konzeptionelle Ursprünge und personale Vernetzungen auf, die bis in die dreißiger Jahre zurückgehen. In weiteren Kapiteln schildert sie die Tagungen, Probleme um die Institutionalisierung und Selbstverständnis sowie Selbstdarstellung des »Konstanzer Kreises«, der sich um Theodor Mayer gebildet hatte. Sie stellt die inneren Strukturen des Konstanzer Arbeitskreises dar und beschreibt Entwicklung und Veränderungen, die er seit 1968 insbesondere unter dem Vorsitz Helmut Beumanns (1972 – 1988) erfuhr. Die besondere Note dieser Darstellung liegt in der Verbindung von Insiderwissen mit systematischer Quellenarbeit und ausgreifender Literaturkenntnis.
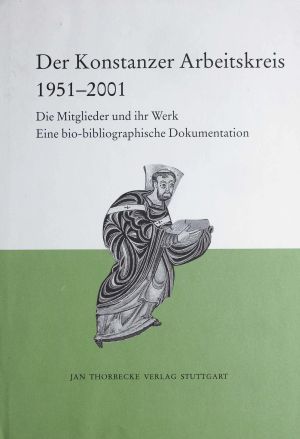
Der Konstanzer Arbeitskreis 1951 – 2001
2001
Die Mitglieder und ihr Werk. Eine bio-bibliographische Dokumentation.
Im Oktober 2001 feiert der »Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte« sein fünfzigjähriges Bestehen. Was als Institut für die Geschichte des BodenseeRaums begonnen hat, ist heute eine Institution der europäischen Mediävistik: Der Verein widmet sich zweimal im Jahr auf mehrtägigen, thematisch gefaßten Sitzungen der Erforschung des Mittelalters in der ganzen Breite seiner Aspekte. Die überarbeiteten Tagungsbeiträge erscheinen in der Schriftenreihe der "Vorträge und Forschungen", die im Jan Thorbecke Verlag erscheint und mittlerweile über fünfzig Bände umfaßt. In diesem Band werden die bisher fünfundfünfzig Mitglieder des Arbeitskreises mit biobibliographischen Einträgen vorgestellt. Aus den reichhaltigen bibliographischen Nachweisen eröffnen sich ganz neue Aspekte im individuellen wie auch kollektiven Werk namhafter Forscher.